Vom Mythos und der Poesie des Geldes
|

|
Die Entwicklung der exorbitanten Staatsverschuldung in den USA, in Japan, Griechenland, Italien und Portugal, die Bonitätsbewertungen der Ratingagenturen und die globale Angst vor einer hohen Inflation werden gegenwärtig in den Medien ausführlich diskutiert, weil viele Bürger um ihr Geld besorgt sind.
Blicken wir fünf Jahre zurück: Die von der Presse damals weltweit als Sensation empfundene Entscheidung des Osloer Komitees, dem Wirtschaftsprofessor Muhammad Yunus aus Bangladesch und der von ihm gegründeten Grameen Bank im Jahre 2006 den Friedensnobelpreis zu verleihen, hatte vielen Kommentatoren eine Erkenntnis wieder vor Augen geführt: Neben der Liebe gibt es wohl kaum ein Thema, zu dem wir Menschen so viele Bewertungen und Glaubenssätze aufgestellt haben wie zum Geld.
Harald Weinrich hat schon 1976 eine bahnberechende Untersuchung zur Metaphorik von Münze und Wort vorgelegt. »Alle Indizien weisen darauf hin« – so konstatierte später Jochen Hörisch in seiner Essay-Sammlung Gott, Geld, Medien (2004) – »dass Geld nach Sprache das zweit-wichtigste und in vielen Kontexten vor Sprache das wichtigste Medium ist.« Das findet seinen Niederschlag in der Alltagssprache, in Literatur, Theologie und Philosophie.
Rund zwei Dutzend leicht benennbare Synonyme für allgemeine Geldbezeichnungen (von Asche, Knete und Kohle über Mäuse, Moneten und Peseten bis zu Piepen, Zaster und Penunzen*) werden im Deutschen ergänzt durch unbestimmte Mengenangaben über den schnöden Mammon (ein Batzen Geld, ein Haufen Kies, eine schِöne Stange Geld) sowie eine Vielzahl umgangssprachlicher Ausdrücke und Redensarten. Wir sprechen vom dicken, heißen, schmutzigen, schnellen oder schwarzen Geld, manche hauen das Geld auf den Kopf, andere schmeißen das Geld zum Fenster hinaus. Jeder von uns kennt neben dem Grimmschen Märchen vom Sterntaler (1857) eine Fülle von Sprichwöِrtern über das Geld, wobei sich bekanntlich für jedes einzelne ein Antisprichwort finden läßt, da diese Weisheiten lediglich auf Erfahrungen beruhen und kein logisches System beinhalten. Sprichwöِrtliche Dialektik hat sich besonders Bertolt Brecht zu Nutze gemacht, sehr deutlich – wie der in den USA wirkende Germanist Wolfgang Mieder kürzlich bemerkte – in einem vierzeiligen Epigramm aus dem Jahre 1932: »Ach, des Armen Morgenstund / Hat für den Reichen Gold im Mund / Eines hätt’ ich fast vergessen: / Auch wer arbeit’, soll nicht essen«: Dabei, so Mieder, variiert Brecht »bewiesenermaßen auch heute noch populärste deutsche Sprichwort Morgenstund hat Gold im Mund und fügt als verdoppelte Anklage noch eine Verfremdung des biblischen Sprichwortes Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen (2. Thessalonicher 3, 10) hinzu.«
»O Geld, du Sorgenkind, du Vater falscher Herzen! Dich haben bringt Gefahr, nicht haben bringet Schmerzen« schrieb Martin Opitz, der bedeutende Barock-Autor und Begründer der Schlesischen Dichterschule, im Jahre 1646. Es fällt auf, daß sich die Literatur an den Grundsatz, daß man über Geld nicht spricht, niemals gehalten hat. Die Protagonisten vieler deutscher Dramen, Erzählungen und Romane sind seit Jahrhunderten bis heute mit dem faszinierenden Medium des Geldes befaßt – seien es ein Lottogewinner (380 Friedrichd`or in der Hamburger Lotterie!) wie der Student Pätus in der sozialkritischen Tragikomِdie des Sturm-und-Drang-Schriftstellers Jakob Michael Reinhold Lenz (Der Hofmeister, 1774), ein Spieler wie in Fjodor Dostojewskis gleichnamigem Roman (1866), Entführer wie bei Wilhelm Hauff (Wirtshaus im Spessart, 1828), Bankvorstände wie in Rolf Hochhuths provokantem Theaterstück McKinsey kommt (2004) oder ganz einfach Menschen, die – wie in Ernst-Wilhelm Händlers jüngstem Roman (Wenn wir sterben, 2002) – durch das Kapital zu Funktionsträgern degradiert werden, weil ihr Leben zum bloßen Joint Venture verkommen ist.
Welt und Geld – über diese mittlerweile entwerteten Reimworte bemerkt Jochen Hörisch in seiner lesenswerten Untersuchung Kopf oder Zahl: Die Poesie des Geldes (1998): »Wer sich auf die Welt einen Reim machen will, kann sich am Himmelszelt oder eben am Geld orientieren.« Martin Treu, als wissenschaftlicher Mitarbeiter des reformationsgeschichtlichen Museums in Sachsen-Anhalt mit der Materie bestens vertraut, stellte im Jahre 2000 anläßlich einer Ausstellungseröِffnung die Frage, ob Martin Luther als scharfer Kritiker der Geldwirtschaft »öffentlich Wasser predigte und heimlich Wein trank?« Immerhin hinterließ der Reformator und Wittenberger Professor, der als Mِönch Besitzlosigkeit gelobt, zeit seines Lebens Zurückhaltung gegenüber materiellen Gütern gelehrt und als Theologe gegen Zinswucher aufgerufen hatte, als er im Jahre 1546 starb, ein beachtliches Vermöِgen. Sein aus Immobilien, Kunstwerken, Silberbechern, Juwelen und Büchern bestehender Nachlaß wird auf den Wert von neuntausend Gulden geschätzt: das entspricht einem heutigen Vermöِgen von einer Million Euro. Martin Treu jedenfalls hält dem Kämpfer gegen die Monetarisierung der Heilserwartung im Ablaßhandel die Treue, gelangt dabei allerdings zu einem bemerkenswerten Urteil: »Von den Geldgeschäften, die er öffentlich so scharf kritisierte, profitierte Luther mit zwei Ausnahmen, so weit wir wissen, nicht. Seit 1541 erhielt er jährlich zum Gehalt die Zinsen in Höhe von 50 Gulden aus einem vom Kurfürsten Johann Friedrich gestifteten Kapitel. Und 1544 bekam er von einer Verehrerin einen Kux, einen Bergwerksanteil, Vorläufer der heutigen Aktien, geschenkt, obwohl er Kuxe früher als Betrug gebrandmarkt hatte. Allerdings wissen wir nicht, was er mit der Aktie getan hat. Damit wird deutlich, daß sich Luther weitgehend an seine eigenen theologische Vorhaben hielt.« Selbst wenn man nicht jedes dieser Treue-Schwüre für bare Münze nehmen wollte, verbliebe bezüglich des Schlusses wohl doch ein Fragezeichen. Eher einsichtig erscheint Luthers Spruch »Wer kein Geld hat, dem hilft nicht, dass er fromm ist« (aus den Tischreden oder Colloquia, herausgegeben 1566).
Geld zu kritisieren ist eine weit verbreitete Übung, die Reaktionäre und Revolutionäre, Schöِngeister, Fromme und Atheisten eint: »Geld ist ein Mörder« sagt man in Litauen, »Geld macht Lotterbuben« heißt es in Polen, »Geld ist ein Seelenverderber« höِrt man in Serbien. Es kann kaum verwundern, daß uns auch beim Marxisten Brecht in dessen Theaterstück Herr Puntila und sein Knecht Matti (1940) die Aussage »Geld stinkt« begegnet, die der reiche Gutsbesitzer freilich nur im Suff äußert. Es ist die Umkehrung des Ausspruchs »Geld stinkt nicht«, den angeblich Kaiser Vespasian (9–79 n. Chr.), nachdem er eine Steuer für Bedürfnisanstalten eingeführt hatte, als »Pecunia non olet« seinem Sohn Titus entgegen hielt, als er von diesem deswegen zur Rede gestellt wurde.
Unpopuläre moralische Postulate wie z. B. die ethischen Lehrsätze aus der Schule der Stoiker ansprechend und publikumswirksam darzustellen – das war auch die erklärte Absicht des rِömischen Politikers, Anwalts und Philosophen Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.). In seiner Schrift Paradoxa Stoicorum aus dem Jahre 46 v. Chr. gibt er auf die Frage »Welchen Menschen bezeichnen wir als reich?« die Antwort: »Meiner Meinung nach nur jemanden, der über einen so großen Besitz verfügt, daß er ohne weiteres dazu in der Lage ist, in Würde zu leben.«
Von diesem ciceronischen Geist scheint das norwegische Nobel-Komitee beflügelt gewesen zu sein, als es den 66-jährigen Yunus und sein Geldinstitut überraschend dafür würdigte, mit Kleinst-krediten für die arme Landbevöِlkerung Bangladeschs »sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung von unten« und somit zum Frieden im Lande beigetragen zu haben.
Trauriges Fazit der FAZ am 5. Mai dieses Jahres:
»Der Nobelpreisträger Muhammad Yunus ist 71 Jahre alt. Er ist mit seiner Arbeit noch nicht fertig. Und doch ist er am Ende seiner Karriere angekommen. Auf Weisung des Staats Bangladesch muss Yunus die Leitung der Mikrokreditbank Grameen abgeben. Die Gerichte haben seine Abberufung bestätigt. Über seine Petition ans höchste Gericht, das höchstrichterliche Urteil zu widerrufen, wurde seit Montag verhandelt. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Das oberste Gericht bestätigte an diesem Donnerstag die Regierungsentscheidung zur Entlassung von Yunus. Damit sind die rechtlichen Möglichkeiten endgültig erschöpft. Es war Yunus' letzter verzweifelter Versuch, die Macht zu retten. Er ist gescheitert.«
|

Karikatur: Detlef Surrey, Titelblatt zu »Knete, schnöder Mammon«, Elefanten Press Verlag GmbH, Berlin, 1987
|
*Zu linguistischen Aspekten der monetären Terminologie vgl. die Arbeiten des Verfassers: Lauter spitze Zungen: Geflügelte Worte und ihre Geschichte und Von Treppenwitz bis Sauregurkenzeit. Die verrücktesten Wörter im Deutschen, beide erschienen bei C.H. Beck, München.
|
Christoph Gutknecht - red. 31. Juli 2011
ID 00000005305
Weitere Infos siehe auch: http://www.chbeck.de/productview.aspx?product=15717
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
ANTHOLOGIE
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
THEMEN
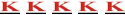
= nicht zu toppen
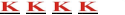
= schon gut
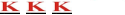
= geht so

= na ja

= katastrophal
|