 Filmkritik und Kommunale Kinos
Filmkritik und Kommunale Kinos
|
Was sind die Aufgaben von Kommunalen Kinos in einer veränderten Kinolandschaft? Der Kampf gegen den Verlust von Geschichte, gegen einen dem Prinzip der Profitmaximierung unterworfenen Aktualitätszwang. Sie dürfen nicht den Fehler der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten wiederholen: dem populistischen Quotendenken der Privaten nachzueifern.
Ihre Hauptaufgabe ist die Pflege des ansonsten in Kinos nicht gezeigten Films und der Filmgeschichte, die systematische Bereitstellung eines Kanons, der eine sinnvolle Verständigung – auch über heutige – Filme erst möglich macht, Filme in der Regel in Originalfassung zu zeigen. Sie sollten den Zustand der Kopie vorher ankündigen, das Publikum erziehen durch ausdauernde und berechenbare Angebote: einen festen Dokumentarfilmtag; Kurzfilme als verbindliches Vorprogramm; „Zyklen“ (siehe das Arsenal in Berlin und das Österreichisches Filmmuseum in Wien); begleitende Einführungen (wie bei Konzerten mit zeitgenössischer Musik); anspruchsvollere Programmzeitschriften.
Dafür ist die Unterstützung der lokalen Filmkritik einzufordern.
Das Problem: junge Kritiker kennen selbst die Filmgeschichte nicht mehr. Wünschenswert wäre eine enge Zusammenarbeit von Kommunalen Kinos und Presse: durch Pressevoraufführungen, Hinweise auf Wiederholungen von Filmen zu späteren Terminen für die Anlage eines Archivs von Vorauskritiken. Kritiker dürfen nicht einfach aus Filmgeschichten abschreiben. Sie müssen Bezüge herstellen zu den aktuellen Sehgewohnheiten, ältere Filme unter heutigen Gesichtspunkten beurteilen, eventuell auf Remakes eingehen, die dem potenziellen Publikum bekannter sind als die Originale. (Scarface, The Postman Always Rings Twice und Ossessione etc.)
Die Kommunalen Kinos müssen Gegendruck machen gegen die Angepasstheit an den Status quo und die Abhängigkeit der Medien von den Anzeigenkunden. Folgende Alternativen sind deutlich als Widersprüche kenntlich zu machen: PR vs. Kritik, Ware vs. Kunst (Wer rezensiert im Feuilleton röhrende Hirschen?), Hollywood vs. europäischer Film, Filme der Dritten Welt, Independent Cinema, Aktualität vs. Geschichte, „verwertbare“ vs. aufklärerische Kritik.
Ein Problem bei einmaligen Aufführungen ist der Gegensatz von Voraus- und Nachkritik. Kritik erschöpft sich nicht als „Kaufempfehlung“. Wichtiger als Wertung sind Analyse, Interpretation, Argumentation, eine „Schule des Sehens“, Alternativen zum „Inhaltismus“, auch Ideologiekritik und sozial-politische Einordnung.
Kommunale Kinos sollten vermitteln, dass der Film nicht (nur) von Stars gemacht wird, sondern von Regisseuren, Kameramännern und -frauen, Drehbuchautoren, Komponisten etc.
Wie ist das durchsetzbar? Durch Gespräche mit den Kritikern und den Feuilletonchefs. Durch die Bildung einer Lobby. Durch die Ermutigung von Laienkritiken in einer „Klubzeitschrift“, z.B. in Zusammenarbeit mit Schulen, oder durch Gründung von Filmklubs. Durch die Verstärkung der Kommunikation am Ort (vgl. die Literaturhäuser) zur Bindung eines Publikums an die Kommunalen Kinos und wiederum zur Schaffung einer Lobby. Und durch Fortbildungsseminare auch für Kritiker.
Übrigens: die Fußball-EM sticht in den Nachrichten- und Kommentarsendungen zurzeit alles aus, was sonst noch auf der Welt passiert. Was wiegen ein paar hundert Tote in der Ukraine, in Gaza oder sonstwo gegen ein deutsches Tor? Ein Kommunales Kino in Stuttgart kommt gar nicht vor. Es gibt seit vielen Jahren keines. Kein Public Viewing, keine Beunruhigung wegen des Verlusts eines kulturellen Interesses. Ein geschlossenes Kino für Filmkunst beunruhigt die Medien weniger als ein geschlossener Bierstand in der Fanzone. Na denn Prost!
|
Thomas Rothschild - 26. Juni 2024
ID: 2798
|
 Aufklärung über Margarine hinaus
Aufklärung über Margarine hinaus
|
Dass das deutsche Fernsehen – das private sowieso, aber auch das öffentlich-rechtliche – ein aufklärerisches Unternehmen sei, lässt sich wohl kaum behaupten. Abend für Abend und mehr noch Vorabend für Vorabend häufen sich Sendungen, die als Schwachsinn zu bezeichnen einem Lob gleichkommt. Dass ihnen die Einschaltquoten recht zu geben scheinen, belegt bestenfalls, dass der Schwachsinn auch große Teile der Zuschauer erfasst hat.
Dagegen hat die Aufklärung einen schweren Stand. Zu den wenigen Lichtblicken im Programm gehören die Sendungen, in denen Sebastian Lege demonstriert, woraus Lebensmittel bestehen und wie sie gemacht werden. Freilich kann man sich fragen, ob diese Sendungen eine Chance haben gegen die massive Werbung für genau die Produkte, deren Schwindel Sebastian Lege aufdeckt. Konsumentenberatung unterliegt in unserer Gesellschaft stets der Profitmaximierung, und auch das von den Konsumenten finanzierte Fernsehen ist nicht wirklich willens, daran etwas zu ändern.
Warum aber, muss man sich wundern, steht Sebastian Leges Analyse von Nahrung, die im besten Fällen bei genauer Betrachtung bloß ekelhaft, häufig aber sogar schädlich ist, so einsam in der Fernsehlandschaft. Warum findet Aufklärung nicht im täglichen Programm statt? Wo bleibt der Sebastian Lege für Gebrauchsgegenstände des Alltags? Welcher Spezialist zerlegt buchstäblich neue Autos, um zu überprüfen, ob sie ihren Preis wert sind? Welcher Intellektuelle analysiert Montag für Montag das vorausgegangene Wort zum Sonntag auf seine Logik, seine Vereinbarkeit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, seine moralischen Prämissen? Wer breitet sich regelmäßig über Fake auf allen Gebieten aus? Kurz: wer hält dem grassierenden Irrationalismus Vernunft entgegen, in einem Ausmaß und einer Ausführlichkeit, die jenem von Fernsehen gewährt wird?
Wir sind weit, sehr weit davon entfernt. Im Rundfunkstaatsvertrag heißt es:
„Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten.“
Sebastian Lege kommt diesem Auftrag nahe. Er strampelt sich ziemlich alleine ab. Es ist ja schon begrüßenswert, wenn wir erfahren, wie Margarine entsteht. Aber das reicht nicht. Jedenfalls nicht, wenn man Europa nicht nur als Erben des Katholizismus und der Reformation, sondern auch, vielleicht sogar vor allem, der Aufklärung begreift.
|
Thomas Rothschild – 23. Mai 2024
ID: 2791
|
 Ohne Verstand und Knollennase
Ohne Verstand und Knollennase
|
Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Schwätzer von mittelmäßigen intellektuellen Gaben mit wichtigtuerischer Miene über die Medien einen Schmarren von sich gibt. Und kein Redakteur, kein Dramaturg gebietet Einhalt. Anlässlich des 100. Geburtstags von Loriot strahlen die deutschen Fernsehsender eine Dokumentation über diesen Satiriker aus. Darin behauptet ein Klugscheißer, er werde im nicht deutschsprachigen Raum wegen seiner kunstvollen Sprache nicht verstanden. Als Beweis führt er das Wort „Auslegerware“ an, für das es in anderen Sprachen keine Entsprechung gebe.
Das ist natürlich kompletter Unsinn. Loriots Sprache ist nicht erfindungsreicher oder komplexer als es die Verse von Edward Lear, die Bildergeschichten von Edward Gorey oder die Filme der Marx Brothers sind. In all diesen Fällen kommt es nur darauf an, einen überdurchschnittlich begabten Übersetzer zu finden – Wolfgang Hildesheimer zum Beispiel oder H.C. Artmann –, der die Sprache, aus der übersetzt wird, und jene, in die übersetzt wird, hinreichend beherrscht und genügend schöpferische Fantasie besitzt.
Die Interviewpartner in Dokumentationen wie jener über Loriot gehören nicht dazu. Sie gleichen vielmehr jenen Figuren, die Loriot karikiert hat. Auch ohne Knollennase.
Im Übrigen hätte es nicht geschadet, wenn man bei aller Bewunderung für den massentauglichen Publikumsliebling im Zusammenhang mit der Frage, ob und inwiefern er politisch sei, an seinen Altersgenossen Wolfgang Neuss erinnert hätte. Es gibt da schon mehr als graduelle Unterschiede, die eine Analyse verdienten. Aber so ist das halt mit dem selektiven systemkonformen Gedächtnis. So wird Evelyn Hamann unwidersprochen als die erste Komikerin im Fernsehen gefeiert, als hätte es nie eine Helga Feddersen gegeben.
|
Thomas Rothschild - 30. März 2024
ID: 2788
|
 Wolfgang Neuss als Maßstab
Wolfgang Neuss als Maßstab
|
Den 30. Dezember hat 3sat von früh bis sehr spät als „Thementag“ der Comedy und dem Kabarett gewidmet. Er wurde zum Fanal. Selten hat das Fernsehen so deutlich gemacht, wohin das politische Kabarett in den vergangenen Jahren verschwunden ist, welchen intellektuellen und humoristischen Niedergang seine Ersetzung durch jene Gattung bedeutet, die sich aus den USA den schillernden Begriff der Comedy geliehen hat. Am Nachmittag montierte es in einem Dauerlauf Kurzauftritte von Comedians, die sich an thematischer Belanglosigkeit und darstellerischem Unvermögen selbst dort noch übertrafen, wo man den Tiefpunkt erreicht zu haben glaubte.
Und dann kam Urban Priol mit seinem Jahresüberblick TILT!, live aufgenommen elf Tage zuvor in Halle an der Saale. Damit hat sich 3sat selbst einen Bärendienst erwiesen und dem Publikum eine Sternstunde beschert. Der mittlerweile 61jährige beförderte den Thementag der vorausgegangenen Stunden mit jedem Satz, mit jeder Pointe ins Abseits. Er braucht keine Grimassen, keine selbstgefälligen Pausen, die einem leidensfähigen Publikum signalisieren sollen, „Seht doch her, wie komisch ich bin“, keine eitle Koketterie mit eigenen Mängeln. Sein Kabarett ist in erster Linie Sprach- und Sprechkunst, einschließlich der alten Varieté-Disziplin der Imitation bekannter Personen. Was Priol in eineinhalb Stunden vortrug, ist inhaltlich ganz nah an den Fernsehnachrichten und Reportagen, an „Spiegel“-Gesülze und Illustrierten-Schwachsinn, die man im vergangenen Jahr sehen, hören und lesen konnte. Das Meiste wusste man, und wenn man es nicht wusste, verstand man Priols Andeutungen auch nicht. Zum Kabarett wurde es durch die leicht verschobenen Formulierungen, durch die schräge Perspektive. So wurde aus den scheinbar sachlichen, „objektiven“ Meldungen aus Deutschland und der Welt politische Aufklärung, die sich nicht davor drückt, Stellung zu beziehen. Respektlosigkeit gehört zur Methode, Widerspruch gegen den medialen Konsens zu den Tugenden.
Urban Priol ist einer der letzten verbliebenen Repräsentanten eines politischen Kabaretts, wie es in Deutschland Wolfgang Neuss, Dieter Hildebrandt oder Georg Schramm geprägt haben. Dass es in Nischen gedrängt wurde, ist kein Versehen, sondern Absicht. Die Comedy hat neben vielen anderen Strategien die Aufgabe, die Rede von sozialer Ungerechtigkeit, von der Lüge der „Trickle-down-Theorie“ oder „Pferdeäpfel-Theorie“, die Priol beim Namen nennt, aus der Öffentlichkeit zu verbannen zugunsten der Problemchen, denen die Comedians ihre Lacher abringen.
Urban Priols Tilt! 2022 kann noch bis zum 1. März 2023 in der Mediathek von ZDF und 3sat abgerufen werden. Es lohnt sich.
|
Thomas Rothschild – 31. Dezember 2022
ID: 2758
|
 Citizen Kretschmann
Citizen Kretschmann
|
In dem Film Citizen Kane kauft der Eigentümer des Inquirer die gesamte Redaktionsmannschaft des konkurrierenden Chronicle ein. Sein Freund Jedediah Leland stellt dem Kollegen Bernstein eine rhetorische Frage: „Do we stand for the same things the ‚Chronicle‘ stands for, Bernstein?“ Bernstein antwortet: „Certainly not. Listen, Mr. Kane, he'll have them changed to his kind of newspapermen in a week!“ Darauf Leland: „There's always a chance, of course, that they'll change Mr. Kane, without his knowing it.“
In Baden-Württemberg hat man vor Jahren – es scheint wie eine Ewigkeit – die Grünen zur stärksten politischen Kraft und mit ihr Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten gewählt. Den Wahlsieg verdankten sie damals dem Widerstand gegen Stuttgart 21. Das ist längst vergessen. Der Slogan von einst – Wir bleiben oben – ist ein leeres Versprechen geblieben. Vom Stuttgarter Bahnhof steht nur noch ein Fragment, drum herum haben sich die Spekulanten breit gemacht, und eine Tunnellandschaft bahnt der Bahn einen Weg: unten. Der Popularität von Kretschmann hat es nicht geschadet. Er kann tun und lassen, was er will, das Wahlvolk zuckt nur mit der Schulter, wenn er dem bekannten Ausspruch Konrad Adenauers folgt: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern!“
Wie ein Jungverliebter gab Kretschmann flugs dem Werben einer CDU nach, der man manches nachsagen kann, aber gewiss keine grünen Neigungen oder eine Abwehr von Stuttgart 21, das sie schließlich eingefädelt hat. Jetzt hat ausgerechnet Hans-Ulrich Rülke, der Vorsitzende der FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, die bislang nicht durch eine besondere Nähe zu den Grünen aufgefallen ist, Kretschmann für das Amt des Bundespräsidenten ins Gespräch gebracht. Wer ist da weiser geworden? Die FDP oder Winfried Kretschmann?
„Stehen wir für die selben Dinge, für die die FDP steht, Trittin, Ströbele, Baerbock?“ „Gewiss nicht. Hören Sie zu, Herr Kretschmann, er wird sie innerhalb einer Woche zu Politikern seiner Art verändert haben.“ „Es gibt freilich immer eine Möglichkeit, dass sie Herrn Kretschmann verändern werden, ohne dass er es merkt.“
|
Thomas Rothschild - 1. Juni 2021
ID: 2728
|
 Das Ende des Genres
Das Ende des Genres
|
Der Film hat von seiner Geburt Ende des 19. Jahrhunderts an, schon in seinen mehr als 30 stummen Jahren, Genres herausgebildet. Zu den frühesten gehörte der Western, aber auch der Gangsterfilm konnte sich sehr schnell als Genre etablieren. Nicht auf Innovation kam es in erster Linie an, sondern auf die Virtuosität bei der Durchführung eines vorgegebenen Schemas, wie das in den anderen Künsten bis weit ins 18. Jahrhundert gang und gäbe war.
Der Genrefilm konnte sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts behaupten. Stets aufs Neue stellte er eine Herausforderung für Regisseure dar. Als sich das Ende des Westerns bereits ankündigte, sprach man vom Spätwestern. Manche Genres kamen hinzu, manche, wie etwa der Kriegsfilm oder der Katastrophenfilm, auch das Filmmusical standen nur für kurze Zeit im Vordergrund, andere, wie der Porno, überlebten im Verborgenen.
Heute existieren die Filmgenres, kaum als solche erkennbar, allenfalls in Überresten. Die Logik der Konsumgesellschaft verlangt immerfort Neues, Originelles. So wie der früher fast obligatorische Establishing Shot durch die eröffnende Detailaufnahme ersetzt wurde, die Ort und Art der Handlung offen lässt und eine Überraschung verspricht, so ist das Genre mehr oder weniger verschwunden. Mit dem Western ist auch der Western-Fan verschütt gegangen, der den Gang von John Wayne nachahmen konnte oder den Slang des typischen Bösewichts.
Mit den Genres freilich, und das ist fast noch bedauerlicher, ist auch ihr humoristisches Gegenstück verloren gegangen: die Parodie. Sie verlangt, um verstanden zu werden, ein vertrautes, allgemein bekanntes Muster. Wo es keinen Western mehr gibt, kann es auch keine Parodien geben wie Destry Rides Again, 4 for Texas oder Cat Ballou, wo der Gangsterfilm nicht geläufig ist, können auch Parodien wie The Ladykillers, Ocean's Eleven, Charade oder Robin and the 7 Hoods nicht funktionieren – allesamt Highlights des komischen Films.
Wer derlei bedauert, wird als rückwärtsgewandt und vergreist bespöttelt. Meinetwegen. Aber man nenne mir den Ersatz für die Verluste. Die Digitalisierung? Die Tricks aus dem Computer? Wie hätte man im Western gesagt? Scheiß drauf.
|
Thomas Rothschild - 17. März 2021
ID: 2719
|
 Weihnachten
Weihnachten
|
Er gehört zu Weihnachten wie das Amen zum Gebet: Frank Capras Film It's a Wonderful Life (Ist das Leben nicht schön?) von 1946. Er handelt von George Bailey, der vom Selbstmord abgehalten wird durch den Engel Clarence, der ihn davon überzeugt, wie viel Gutes er für andere getan hat.
Das Negativ zu diesem Rührstück liefert ein anderer Weihnachtsklassiker, A Christmas Carol von Charles Dickens. Diese Erzählung handelt von dem verabscheuungswürdigen Geizhals Ebenezer Scrooge, dem Geister vor Augen führen, wie viel Leid er anderen zugefügt hat, und der unter dem Eindruck dieser Visionen der gute Mensch wird, der George Bailey immer schon war.
Dieses Muster ist in der Literatur vor und nach Dickens unzählige Male abgewandelt worden, meist mit dem Subtext, dass Geld nicht nur nicht glücklich, sondern hässlich und böse macht. Zu den bekanntesten Exemplaren gehören die Besserungsstücke von Ferdinand Raimund, Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär und Der Alpenkönig und der Menschenfeind. Noch Ingmar Bergmans vielleicht bester Film Wilde Erdbeeren variiert dieses Schema und nähert es dem 20. Jahrhundert an, indem er die mahnenden Geister oder Allegorien durch aufklärerische Träume ersetzt.
Was Autoren so oft und so lange umtreibt, müsste doch, so sollte man meinen, Gewicht haben. Das Gegenteil ist der Fall. Die genannten Beispiele und viele mehr beweisen nur die Wirkungslosigkeit der Künste. Hat auch nur ein Mensch unter dem Eindruck von Raimund, Dickens oder Bergman darauf verzichtet, Geld anzuhäufen, und sich stattdessen dem Wohlergehen seiner Mitmenschen verschrieben? Hat die Bosheit durch den Einfluss von Literatur abgenommen? Kennt man jemanden, der sich gesagt hätte, so wie Ebenezer Scrooge, wie Fortunatus Wurzel, wie Herr von Rappelkopf, wie Professor Isak Borg vor ihrer Läuterung waren, möchte ich nicht sein, und auch danach gehandelt hätte?
Zu Weihnachten geben wir unseren sentimentalen Empfindungen nach. Vor dem Fernsehschirm oder beim Vorlesen unter dem Christbaum. Und danach: weiter wie bisher. Wer an die erziehende Wirkung der Künste glaubt, mag sympathisch sein. Auf alle Fälle ist er naiv.
|
Thomas Rothschild - 18. Dezember 2020
ID: 2710
|
 Wider den US-Kolonialismus
Wider den US-Kolonialismus
|
Noch nie hat sich der Satz von Wim Wenders, dass die Amis unser Unterbewusstsein kolonialisiert haben, so sehr bewahrheitet, wie in unserer Gegenwart. Mit dem Streaming hat sich dieser beklagenswerte Zustand intensiviert. Woche für Woche empfehlen Zeitungen und Zeitschriften als willfährige Kolporteure des Status quo und der Profitinteressen die angeblich „besten Serien“, die man im Programm der Fernsehanstalten aufsuchen oder sich bei Netflix & Co. herunterladen kann. Kritiklos nehmen sie hin, dass neben den meist minderwertigen deutschen Elaboraten – Babylon Berlin ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt – fast ausschließlich Importware aus den USA zur Verfügung steht. Als gäbe es zwischen Tokio und Vancouver, zwischen Johannesburg und Oslo keine Filme und keine Fernsehserien. Das dänische Borgen war auch in dieser Hinsicht die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Man nenne einen einzigen triftigen Grund, weshalb, um ein Beispiel zu nennen, zwei grandiose Literaturverfilmungen des Russen Vladimir Bortko niemals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, ja nicht einmal für DVD synchronisiert oder deutsch untertitelt wurden: Dostojewskis Idiot von 2003 und Bulgakows Meister und Margarita von 2005. Beide Serien halten sich mit je zehn Episoden von insgesamt rund neun Stunden eng an die sehr unterschiedlichen literarischen Vorlagen, sind aber zugleich filmisch anspruchsvoll und schauspielerisch den deutschen Serien in einem Maße überlegen, das einen Vergleich eigentlich verbietet. Die Romane, die ihnen zugrunde liegen, gelten zu Recht als Meisterwerke der Weltliteratur. Wie sollten die Serien also „zu russisch“ oder gar unverständlich sein, um in Deutschland ein Publikum zu finden? Die Amis haben unser Unterbewusstsein kolonialisiert. Und wenn nun jemand einwendet, er wolle keine Fernsehserien aus dem Land Putins sehen, sei daran erinnert: der Präsident der USA heißt Donald Trump. Jedenfalls bis morgen.
|
Thomas Rothschild – 2. November 2020
ID: 2702
|
 Deadwood
Deadwood
|
Zu den filmisch wie inhaltlich besten Fernsehserien seit The Sopranos gehört Deadwood, das in den USA von 2004 bs 2006 erstmals ausgestrahlt wurde. Darin ist jedes dritte Wort, insbesondere von dem Inhaber des Saloons und Bordells Gem Variety Theater Al Swearengen, "fuck" oder "cocksucker". Darüber hinaus werden Schwarze, Chinesen und Juden laufend mit diskriminierenden Schimpfwörtern bedacht. Es ist kaum anzunehmen, dass sich heutige Zuschauer diese rassistischen Bezeichnungen zu eigen machen oder sie auch nur goutieren. Wenn man sie aber, wie das heute zum guten Ton gehört, streicht oder durch neutrale Begriffe ersetzt, beraubt man sich der Möglichkeit, eine rassistische Gesellschaft zu zeigen. Jede Sprachkosmetik dient in diesem Fall der Geschichtsfälschung, mehr noch: der Exkulpation von Zuständen, die die Serie gerade anzuklagen bestrebt ist.
Deadwood ist jedoch auch in anderer Hinsicht interessant und aktuell. Die Serie spielt in den Jahren 1876-1878. Sie zeigt eine neu gegründete Goldgräbersiedlung in South Dakota in einer Epoche, in der sich Law and Order erst allmählich durchsetzten. Man reicht sich die Hände, in die man zuvor gespuckt hat. Das genügt, um einen Vertrag zu besiegeln, an den man sich hält oder eben nicht hält. Prostituierte werden importiert und wie Gefangene in Käfigen gehalten. Es herrscht das Recht des Stärkeren, offenkundige Morde bleiben ungesühnt, ein staatliches Gewaltmonopol steht noch in den Sternen. South Dakota wurde erst 1889, also nach der Zeit der Handlung von Deadwood, als Bundesstaat in die USA aufgenommen. Im Film Deadwood von 2019, der an die Serie anschließt, wird das zum Hintergrundsthema.
Man muss sich vor Augen halten: die „Helden“ von Deadwood, für die es größtenteils historische Vorlagen gab, Al Swearengen, Seth Bullock, George Hearst, Calamity Jane, „Wild Bill“ Hickok waren Zeitgenossen von Émile Zola, Karl May, August Strindberg, Oscar Wilde, Sigmund Freud, Carl Benz, August Bebel, Paul von Hindenburg. Die Story von Deadwood liegt gerade vier bis fünf Generationen zurück. Aber die Verhältnisse westlich von New York, Boston und Chicago unterschieden sich grundlegend von jenen in Frankreich, England oder Deutschland. Deadwood liefert davon ein anschauliches Bild. Und macht schlagartig verständlich, was uns gemeinhin so rätselhaft erscheint: wieso ein launischer Rowdy wie Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden konnte.
Der Western, der weitgehend aus der Mode gekommen ist, galt einst als amerikanischer Heimatfilm. Deadwood hat die Klischees des Genres durch eine fast dokumentarische Nähe zu den überlieferten Fakten ersetzt. Sie belehren uns, dass die heroischen Legenden allenfalls im Kopf eines Donald Trump weiterleben. In John Fords The Man Who Shot Liberty Valance sagt der Journalist Maxwell Scott: „When the legend becomes fact, print the legend.“ Donald Trump scheint an diese Legenden zu glauben und verhält sich entsprechend. Das muss man wissen, wenn man den amerikanischen Präsidenten und seine Politik beurteilt. Dieser Tage hielt er just in South Dakota, 80 Kilometer von Deadwood entfernt, eine flammende Rede gegen die Anti-Rassismus-Bewegung.
|
Thomas Rothschild - 16. Juli 2020
ID: 2690
|
 James Bond
James Bond
|
Wenn es eines Beweises bedürfte, dass Sexismus und Rassismus – ganz im Sinne der legendären F-Skala von Adorno u.a. – eng mit einander verbunden sind, könnten die James-Bond-Filme und die ihnen zugrunde liegenden Romane von Ian Fleming einen überzeugenden Dienst leisten. Nach den Maßstäben, mit denen Filme oder auch Theaterstücke heute beurteilt werden, hätten sie seinerzeit zu massiven Protesten führen müssen. Frauen fallen regelmäßig und augenblicklich in die Horizontale, wenn James Bond – egal in wessen Gestalt – sich ihnen nähert. Und die Masterminds des Bösen tragen zwar deutsch klingende Namen – Blofeld, Goldfinger, Stromberg –, aber die ausführenden Übeltäter sind zu einem guten Teil als Asiaten oder Schwarze gekennzeichnet. Ihnen stehen nur sehr wenige „gute“ Figuren gegenüber, die nicht der „weißen Herrenrasse“ angehören. Es gibt kaum ein rassistisches Klischee, das die so erfolgreiche Filmserie, die insgesamt mehr als 15.000 Millionen Dollar eingespielt hat, ausgelassen und nicht mit Nachdruck wiederholt hätte.
Die Frage ist: wie viele von den mehreren Millionen Zuschauern, die im Lauf eines halben Jahrhunderts James-Bond-Filme gesehen haben, wurden durch sie in ihrer Einstellung zu Frauen, Chinesen, Japanern, Afrikanern, auch Russen, dem politischen Hauptfeind der „westlichen Welt“ in den Jahren des Kalten Krieges und des nuklearen Wettbewerbs, und, auf der Höhe der Zeit, zu Nordkoreanern geprägt? Die Medienwirkungsforschung gibt uns nur sehr unzuverlässige und widersprüchliche Antworten. Vieles spricht dafür, dass durch solche Filme lediglich vorhandene Prädispositionen bestärkt werden – der „Reinforcement-Effekt“ –, nicht aber Meinungen produziert werden. Wer schon zuvor der Ansicht war, dass Frauen nur darauf warten, „genommen“ zu werden, dass sie entweder dumm oder hinterhältig sind, dass „Farbige“ gewalttätig seien, mag sich durch solche Klischees bestätigt fühlen. Wenn das aber zutrifft, ist es müßig, gegen Filme, Theaterstücke, Bücher vorzugehen, die diese Klischees transportieren. Verhindert werden müssen Überzeugungen, die für sie empfänglich machen. Es bedarf, um ein eklatantes Beispiel zu nennen, keiner Filme, die Roma und Sinti in diffamierender Weise darstellen. Der Antiziganismus ist, wie Hajo Funke eben erst in der Januar-Nummer von konkret nachgewiesen hat, eine bei der Mehrheit der Deutschen tief verankerte Einstellung. Sie gilt es zu bekämpfen, nicht den Zigeunerbaron oder Carmen.
Wer früh, sehr früh gegen die Anfälligkeit für Sexismus und Rassismus immunisiert wird, wird auch James-Bond-Filme unbeschadet überstehen. Er wird sie als das sehen und mögen oder auch nicht mögen, was sie sind: Märchen für Erwachsene mit einer klaren Trennung von Gut und Böse. Er wird das Kino verlassen wie Kinder die Märchenlektüre. Sie wissen in der Regel ziemlich genau, dass es im wirklichen Leben keine bösen Hexen und keine guten Feen gibt. Wer allerdings daran zweifelt, sollte die James-Bond-Filme zumindest mit der gleichen Vehemenz verdammen wie Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung oder Molnárs Liliom.
|
Thomas Rothschild - 24. März 2020
ID: 2667
|
 Der tägliche Schwachsinn
Der tägliche Schwachsinn
|
Der Schutz vor sexueller Belästigung macht gewaltige Fortschritte. Das ist gut so, und wenn Gerichte dabei Hilfestellung leisten, soll uns das recht sein. Wer aber schützt uns vor der Beleidigung unseres Verstands? Wann melden sich endlich jene Massen, die sich - #Me Too – die tägliche Vergewaltigung ihrer intellektuellen Integrität nicht mehr gefallen lassen wollen?
Ich schalte nur selten den Fernseher ein. Ab und zu aber gerate ich per Zufall in eine Sendung, deren Existenz mir bislang verborgen geblieben war. So dieser Tage Brisant im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seinen Dienst einst mit einem Bildungsauftrag angetreten hat und für den ich immerhin Gebühren bezahlen muss. Da wird berichtet, dass eine Pamela Anderson zum fünften Mal geheiratet hat. Ich weiß nicht, wer Pamela Anderson ist, und nach diesem Beitrag bin ich auch nicht besonders motiviert, mehr darüber zu erfahren. Offenbar aber ist sie so bedeutend, dass es von Relevanz für die Menschheit ist, wenn sie heiratet. Dazu hat auch eine wohl nicht weniger bedeutende „Society-Expertin“ namens Sibylle Weischenberg etwas zu sagen. Unter anderem dies: Sie habe schon lange nichts Schöneres gehört, als dass Pamela Anderso jetzt eine Beziehung auf Augenhöhe gefunden habe. Ihr fünfter Ehemann John Peters, wer immer das sein mag, wird ihr sagen: „Wir machen das jetzt so.“ Originalton Society-Expertin Weischenberg: „Gibt es etwas Schöneres als einen Mann, der sagt, ich sorge für dich (…) und sie muss sich nicht mehr überlegen, ob sie dritter Klasse fliegt oder erster Klasse. Für sie öffnet sich jetzt eine gesicherte Welt.“ Müssen wir uns solch einen Schwachsinn wirklich gefallen lassen? Und was sagen die echten Me Too-Aktivistinnen dazu, dass es als das denkbar Schönste angepriesen wird, wenn man sich eine „gesicherte Welt“ in der ersten Klasse erheiratet hat? Ist der Weg zum Filmproduzenten so weit, der von einer Schauspielerin verlangt, dass sie sich auf die Couch legt, wenn sie eine Rolle bekommen möchte?
Der „gute John Peters“ ist, erklärt uns Sibylle Weischenberg, „bingo“. Er ist reich „und kann für sie sorgen". Was will man mehr. Wer sich nicht so gut verkauft wie Pamela Anderson hat Pech gehabt. Sie wird in Brisant nicht vorkommen. Und wir dürfen wieder darüber diskutieren, ob zu viel Aufhebens gemacht wird um Greta Thunberg.
|
Thomas Rothschild - 23. Januar 2020 (2)
ID: 2656
|
 Stand-up Comedy
Stand-up Comedy
|
Wenn Jazz und Film amerikanische Künste sind, dann gilt das zumindest ebenso sehr für die Stand-up Comedy. Ein Mann, eine Frau steht vor dem Mikrophon und erzählt – das wär's, nichts weiter. Während die Conférence in der Tradition des deutschsprachigen Kabaretts und Varietés lediglich überleitet von der einen Nummer zur anderen, ist Stand-up die Nummer selbst. Und wenn sich Franz Hohler, zum Beispiel, als Theaterdonnerer vorstellt, so wissen wir jeden Moment, dass das eine Rolle ist, wundern uns nicht, wenn er in der nächsten Nummer plötzlich wer ganz anderer ist. Wenn der Alleinunterhalter des Stand-up „ich“ sagt, dann geht er ganz in seiner Rolle auf, hält sie von Anfang bis Ende, meist über Auftritte und Jahre hinweg, bei. Der Zuhörer kann nicht mehr unterscheiden, wo er tatsächlich Erlebtes berichtet und wo er sich etwas ausgedacht hat. Der Stand-up-Komiker identifiziert sich (scheinbar) so sehr mit seiner Rolle, dass er zum Typus wird, den man sich im realen Leben nicht anders denken mag als auf der Bühne.
Woody Allen war, ehe er als Filmemacher zu Weltruhm gelangte, ein begnadeter Stand-up-Comedian. Er konnte auf Anregungen von Jack Benny oder George Burns zurückgreifen. Lily Tomlin ist eine der weniger Frauen im Metier. Und es gibt Aufnahmen von einigen Stand-up-Höhepunkten aus in den Jahren 1959-71 gesendeten Folgen der Ed Sullivan Show, jener legendären Sonntagsserie, die schwächere Gastgeber in den USA und nur noch peinliche Zombies in deutschen Fernsehanstalten immer wieder hilflos kopieren. Fünf Minuten dieser Aufzeichnungen enthalten mehr gescheite Pointen, als ein Harald Schmidt in all seinen Sendungen zusammengenommen zustande gebracht hat. Neben Stand-up-Soli gibt es auch ein paar Sketche, von denen ich einen – von Stiller & Meara: Hershey Horowitz Meets Mary Elizabeth Doyle – hervorheben möchte. Ein Paar, das sich über eine Computer-Vermittlung kennengelernt hat, stellt fest, dass es in der selben New Yorker Straße wohnt, aber sich nicht verständigen kann, weil die beiden völlig unterschiedliche Erfahrungen haben: sie ist Christin, er Jude. Der Dialog ist von fulminantem Witz und zeigt, übertreibend, doch eine drastische Tatsache, dass nämlich der viel gepriesene „mel ting pot“ in Wahrheit ein Konglomerat von Ghettos ist. Die Szene wurde vor Jahrzehnten aufgenommen und wirkt kein bisschen veraltet.
Bei Ed Sullivan begnügte man sich noch nicht mit hysterisch gestikulierenden Kleiderständern und blöd grinsenden, feixenden Gesichtern, aus denen kein hörenswertes Wort dringt. Zu den Stammgästen der Ed Sullivan Show gehörten die Schauspieler und Sänger des Broadway, die Stars der aktuellen Musicals, die mehr zu bieten hatten als allenfalls Auskünfte über ihre jüngsten Liebschaften oder ihre Morgengymnastik. Warum nimmt sich unser Fernsehen nicht daran ein Beispiel? Es gab und gibt ja auch in Europa einige wenige Stand-up-Komiker, die sich an den amerikanischen Stars messen können: Lukas Resetarits, und Josef Hader in Österreich, Arkadij Rajkin in Russland. Ein deutscher Komiker dieses Formats fällt mir nicht ein. Na ja, Gerhard Polt vielleicht, Georg Schramm, Bruno Jonas und Sigi Zimmerschied.
|
Thomas Rothschild - 19. August 2019
ID: 2635
|
|
|

Rothschilds Kolumnen
BERLINALE
DOKUMENTARFILME
DVD
EUROPÄISCHES JUDENTUM IM FILM
Reihe von Helga Fitzner
FERNSEHFILME
HEIMKINO
INTERVIEWS
NEUES DEUTSCHES KINO
SPIELFILME
TATORT IM ERSTEN
Gesehen von Bobby King
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
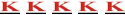
= nicht zu toppen

= schon gut
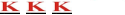
= geht so

= na ja

= katastrophal
|