ADELE
SCHLOMBS
Über die Vergangenheit und Zukunft des Museums für Ostasiatische Kunst in Köln
|

Foto (C) Alexandra Malinka
|
Frau Schlombs, Sie sind seit fast 28 Jahren Direktorin des Museums für Ostasiatische Kunst (MOK) und betonen immer wieder, wie sehr Sie dieses Haus lieben. Was macht denn das Gebäude so besonders für Sie?
Dr. Adele Schlombs: Das Museum für Ostasiatische Kunst in Köln ist eines der wenigen qualitätvollen Gebäude der 1970er Jahre, das noch in Reinkultur erhalten ist. Sein Architekt, der Japaner Kunio Maekawa (1905-1986), gilt in seiner Heimat als Vater der Moderne. Er hat zwischen 1928 und 1930 bei Le Corbusier in Paris gearbeitet, und man kann in seiner Herangehensweise viele Übereinstimmungen erkennen. In der Nachkriegszeit wirkte Maekawa in Japan als die Brücke zur Moderne, denn ähnlich wie in Deutschland gab es auch in Japan faschistische und sehr protzige Architektur. Maekawa war ein herausragender Exponent, und heute sind auf der japanischen Denkmalliste 151 Bauwerke allein von ihm vertreten.
Sie waren bei der Eröffnung des Neubaus 1977 zwar noch nicht Direktorin hier, haben sich aber mit der Vorgeschichte beschäftigt. Die Stadtväter haben damals einen Ort schaffen lassen, bei dem die Architektur und die Nutzung des Gebäudes ein großes Ganzes ergeben. Waren die sich damals im Klaren darüber?
A. S.: Ich glaube schon, dass die sich darüber im Klaren waren. Es gab zwar Ratssitzungen, wo sie sagten: "Warum denn ein japanischer Architekt? Die Telefongebühren, die Flugkosten! Warum nicht ein Architekt aus Deutschland oder noch besser einer aus Köln?" Es war dann vor allem Max Adenauer (ehemaliger Stadtdirektor von Köln), der dagegenhielt und sicher auch diese Vision hatte: "Wir bauen nicht nur ein Gehäuse für die Kunst, sondern wir bauen ein Haus, das als solches schon asiatischen Charakter hat." Das sieht man sofort, wenn man hereinkommt: Die Anspielungen auf die Ständerbauweise, z.B. im Innengarten, dann auch die Transparenz, die Schiebetüren, immer wieder diese Auflösung der Grenzen zwischen innen und außen.
Was wissen Sie noch über die Entscheidungsprozesse damals?
A. S.: Das sind mutige und originelle Menschen gewesen, die das durchgesetzt haben. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis man die Finanzierung parat hatte, ein Drittel Bund, ein Drittel Land NRW und ein Drittel Stadt Köln. Die Planung fand in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre statt. Roger Goepper, der Direktor des Museums für Ostasiatische Kunst in Berlin, wurde 1966 an das MOK in Köln berufen, das Schmackhafte an dem Amt war eindeutig die Aussicht auf einen Neubau. Der Neubau war ein visionärer Schritt in einer Zeit, in der wir finanziell allerdings noch recht gut da standen. Ich habe in den alten Zeitungen nachgelesen: "Die schönste Baustelle der Stadt Köln", hieß es da. Die Felsen des Innengartens stammen von der japanischen Insel Shikoku und wurden eigens nach Köln gebracht. Der Künstler Masayuki Nagare hatte in Japan auch ein großes begehbares Modell gebaut. Das sind Standards, die wir heute bestimmt nicht mehr erreichen.
|

Der Innengarten des Museums für Ostasiatische Kunst in Köln | Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln, Marion Mennicken
|
Sie wurden 1991 Direktorin des MOK und mussten gleich eine Art „Rettungsaktion“ unternehmen.
A. S.: Als ich kam, lagen von der Orientstiftung finanzierte Pläne für eine Museumserweiterung bereits vor. Im Foyer war ein gläserner Aufzug vorgesehen, und die Erweiterung hätte unten im Keller stattgefunden - bei einer Deckenhöhe von 2.30 m. Das war eine Sackgasse. Außerdem hätte man unendlich viele Mittel aufbringen müssen, nur um die vorhandene, voluminöse Klimatechnik zu verlegen, um Raumhöhe zu gewinnen. Ich war damals noch sehr jung, habe mich damit auseinandergesetzt und war durchaus guten Willens. Dann habe ich ausprobiert, wie das großformatige buddhistische Gemälde vom Eingehen des Buddha in das Nirvana bei einer Deckenhöhe von 2,30 m aussieht. Es sah aus wie eine Fototapete. Das ging einfach nicht.
Welche Kunst hätte in den Keller gekonnt?
A. S.: Keine. Wir haben Kunst aus China, Korea und Japan. Wen stopfen Sie in den Keller? Korea vielleicht? Das wäre ja geradezu ein Politikum. Ich habe wirklich versucht, mir die vorhandene Planung anzueignen, aber ich kam überhaupt nicht klar damit und fand das alles verquer. Es war nicht einfach, diese Planung vom Tisch zu bringen. Ich habe mit Frau Professor Kier, der damaligen Generaldirektorin der Museen, gesprochen und sagte zu ihr: "So können wir das nicht machen. Ich muss sonst gehen."
So wie ich Sie einschätze, war es Ihnen ernst damit.
A. S.: Sie müssen auch die Kraft aufbringen, sich einer Sache entgegenzustellen, die Sie für nicht in Ordnung halten. Der damalige Verwaltungsleiter des Dezernats meinte: "Entweder die vorhandene Planung wird ausgeführt, oder Sie können sich die Erweiterung in die Haare schmieren." Diesen Satz werde ich nie vergessen, aber ich dachte, das wollen wir doch mal sehen! Für mich stand fest, entweder muss die Planung geändert werden, oder ich muss gehen, weil ich nicht Verantwortung für etwas übernehmen kann, das ich für falsch halte. Dann habe ich mit verschiedenen Architekten gesprochen, und es war Joachim Schürmann, den ich von früher kannte, der mit mir durch das Museum ging und die zündende Idee lieferte. "Wieso wollt ihr eigentlich in den Keller gehen? Ihr habt hier doch fantastische Büros. Warum machen Sie diese nicht zu Ausstellungsflächen? Dann liegt der Garten in der Mitte. Da brauchen Sie keine gläsernen Aufzüge mit Messingbeschlägen und diesem ganzen Kitsch." Es war natürlich ein großer Aufwand, mit unseren Büros dorthin zu ziehen, wo zuvor die Depots waren, nämlich in das 1. OG. Es wurden dann neue Depots im Keller eingerichtet. Das war im Grunde viel effizienter, weil wir nicht Hunderttausende in die Verlagerung der Klimatechnik investieren mussten, um Raumhöhe zu gewinnen.
Das heißt, dass die bessere Lösung sogar die günstigere war.
A. S.: Genau. Ja. Das ist aber oft so. Weil sich die Menschen so komplizierte Dinge ausdenken und dann unbedingt daran festhalten wollen, weil sie meinen, es gäbe keine Alternative. In den 1990er Jahren war es teilweise schon sehr kitschig, diese gläsernen Aufzüge mit Messing. Das hätte das Foyer wirklich kaputt gemacht, und wir wären danach auch nie mehr in den Denkmalschutz aufgenommen worden. Wenn ein Bau schon so verfremdet ist, dann geht das nicht mehr.
Das Gebäude steht seit 2012 unter Denkmalschutz, was aber nicht nur helle Freude ausgelöst hat.
A. S.: Eigentlich war das ein toller Zufall. 2011 hatte ich in Tokyo zu tun. Als ich mir Maekawas Museum für Westliche Kunst in Ueno mal wieder anschaute, stellte ich fest, dass es gerade zum UNESCO-Weltkulturerbe gekürt worden war. Ich habe alles fotografiert, bin nach Hause zurückgekommen und habe sofort im Eilverfahren den Antrag auf Denkmalschutz gestellt. Der Landschaftsverband Rheinland hat mich dabei sehr unterstützt, obwohl die Stadt Köln nicht glücklich war. Das Dezernat war eher böse. Ich erinnere mich an einen Zeitpunkt, da sagte der damalige Oberbürgermeister: "Der übertriebene Denkmalschutz ist unsinnig." Man müsse doch auch die Effizienz im Auge behalten. Die Stadt war unzufrieden, weil nun bei jeder baulichen Veränderung die Denkmalpflege einbezogen werden muss und nicht mehr aus Prinzip die billigste Lösung gewählt werden kann.
Für den Museumsbau selbst ist das aber ein guter Schutz.
A. S.: Ich hoffe. Mehr kann ich auch nicht tun. Ich finde, dass ein Museum von den Räumlichkeiten her zu der Kunst passen sollte, die darin ausgestellt wird. Im MOK ist es kongenial. Sie finden hier an keiner Stelle Raumfluchten. Das macht man in Ostasien wegen des Feng Shui nicht, weil die vorhandene Energie durch die Raumfluchten verschwinden, einfach „durchzischen“ würde. Für Kuratoren sind die Räume ganz toll, weil die Energie darin immer wieder eingefangen wird, jeder Durchgang eröffnet einen neuen Blickpunkt, eine Wand, mit der man ein neues Thema oder Kapitel initiieren kann. In diesem Gebäude wird immer wieder die Energie zusammengeführt, von Abschnitt zu Abschnitt. Ich bin jetzt schon sehr lange da und kenne das Haus wie meine Westentasche, ich habe das mittlerweile im Gefühl.
Sie sagten einmal, dass die Menschen in 50 Jahren froh sein werden, dass alles weitgehend so erhalten geblieben ist.
A. S.: Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe das in meinem eigenen Leben schon oft erlebt, wie wunderbar es ist, wenn man praktisch in dreidimensionaler Weise eine Zeitreise machen kann. Ich bin ganz sicher, da werde ich schon lange unter der Erde liegen, dass die Leute das irgendwann schätzen werden. Zunächst einmal bin ich dafür aber nicht gerade geliebt worden.
Haben die Verantwortlichen sich das träumen lassen, als sie Sie eingestellt haben, dass diese zarte Person das Haus so tatkräftig verteidigen würde?
A. S.: Das weiß ich nicht. Wenn es wichtig ist, dann bin ich auch hundertprozentig dabei und versuche das durchzusetzen. Ich finde, das muss man auch, man hat eine Verantwortung.
Es hört ja auch nicht auf. Irgendwie ist immer etwas.
A. S.: Ja, wir mussten 2017 für mehrere Monate schließen, weil die Beleuchtungsanlage zusammengebrochen war. Aber ehrlich gesagt, hat sich das gelohnt, denn die neue Beleuchtungsanlage ist eine enorme Verbesserung. Jetzt ist der Deckenspiegel einfach gut. Davor hatte man in den 1980er Jahren diese unschönen Stromschienen auf die Decke gesetzt, da mal ein Rechteck, da mal ein Quadrat, weil die alte Beleuchtung von damals eben nicht ausgereicht hat. Bei der Renovierung mussten alle abgehängten Decken heruntergenommen werden, es war nur noch der Rohbau da. Wir haben viele Kilometer Kabel verlegt und sind jetzt gut gewappnet, auch für Internet und alles, was in der Zukunft auf uns zukommt.
Kurz zur Geschichte: Das MOK basiert auf der Sammlung des Ehepaars Adolf und Frieda Fischer und war im ersten MOK am Gereonswall/Ecke Adolf-Fischer-Straße untergebracht. Die Eröffnung 1913 erlebte Adolf Fischer noch, verstarb aber 1914. Seine Frau Frieda übernahm die Leitung, bis sie 1937 von den Nationalsozialisten abgesetzt wurde. Die 9.000 Exponate umfassende Sammlung konnte vor Kriegszerstörungen bewahrt werden, hatte aber nach der Zerstörung des Museumsbaus keine ständige Heimstatt mehr. Bis 1977...
A. S.: Vor dem Neubau 1977 gab es mal eine Ausstellung im Overstolzenhaus, mal eine im Kupferstichkabinett des Wallraf-Richartz-Museums oder in den Messehallen, oder in der Hahnentorburg. Die Schätze des Ehepaars Fischer konnten immer nur in kleinem Umfang gezeigt werden. Ich bin voller Respekt vor meinen Vorgängern, vor allem vor Werner Speiser, der nie den Museumsneubau gesehen hat und der während seiner gesamten Amtszeit nie mit einem eigenen Gebäude arbeiten konnte. Wenn man eine Sammlungsstrategie entwickeln will, ist es wichtig, dass man die Sammlung in natura erleben kann und nicht nur punktuell. Mit einer Sammlung kann man heute auch nicht mehr bei Null anfangen, sondern lediglich versuchen, vorhandene Schwerpunkte stärker herauszuarbeiten, also Lücken zu schließen und das Vorhandene aufzuwerten. Dass das bei den Skulpturen und Plastiken aus China besonders gut gelungen ist, zeigt sich in der Sonderausstellung Alles unter dem Himmel in den hohen Räumen am Ausstellungsbeginn. Ich finde, die Avantgarde-Kalligrafien bilden einen sehr interessanten Kontrast dazu. Eine wichtige Entdeckung der 1990er Jahre war außerdem die chinesische Literatenkultur, die Möbel und die Objekte des Studierzimmers. Das war ursprünglich nicht auf der Agenda der Museumsgründer, aber es war ein Glück, dass wir durch die Sammlung des Ehepaars Ludwig und eine größere Stiftung diese Lücke schließen konnten.
Inwieweit haben Sie jetzt einen Überblick über die Schätze des Museums?
A. S.: Ich habe im Lauf der Zeit einen guten Überblick über die Bestände gewonnen. Dazu hat der Neubau viel beigetragen. Sie müssen sich vorstellen, bis 1977 Jahre lagerten die Objekte 35 Jahre lang in Kisten. Wenn alles verpackt ist, kann ein Museumsdirektor gar keinen Überblick gewinnen. Man muss die Stücke optisch klar vor Augen haben.
*
Sie erwähnten in der Pressekonferenz zu Alles unter dem Himmel, dass die ostasiatische Kunst immer noch nicht als ebenbürtig betrachtet werde und dass der Grund der deutsche Kolonialismus sei.
A. S.: Ich glaube, dass der deutsche Kolonialismus, aber auch der anderer Länder, noch nicht aufgearbeitet ist. Mir scheint, das ist einer der Gründe, warum alte Sammlungen ostasiatischer Kunst von Verwaltungen gerne als lästige Nebensache behandelt werden. Betrachtet man die Budgets und die Personalsituation, kann man erkennen, dass es so etwas wie eine Museumshierarchie oder eine „Hackordnung“ gibt. Kurz nach der Sommerpause las ich ein Interview mit der Kulturdezernentin zu den Ausstellungshighlights im Herbst 2018. Das Jubiläum des MOK und die Ausstellung Alles unter dem Himmel fand darin keine Erwähnung. Dies ist kein persönlicher Vorwurf. Es handelt sich lediglich um die Feststellung einer Tatsache, die man sich bewusst machen und vielleicht auch einmal hinterfragen sollte.
Zum kolonialistischen Blick fällt mir ein, dass wir in der Ausstellung Alles unter dem Himmel ein Kapitel genau dieser Fragestellung gewidmet haben. Oft kommen ältere Menschen zu uns: "Wollen Sie vielleicht ein Fotoalbum meines Großvaters haben, der im Boxeraufstand kämpfte?" Andere haben uns Exportalben mit Malerei im europäischen Stil auf Markpapier gestiftet. Eine der Serien zeigt Hinrichtungs- und Foltermethoden. Die Europäer in China haben solche Exportalben in Kanton gekauft und als Souvenirs mit nach Hause gebracht. Können Sie sich vorstellen, so etwas als Reiseerinnerung zu kaufen? Oder handkolorierte Fotos, die China als heruntergekommenes Land darstellen, in dem die gesellschaftliche Elite Opium rauchend auf dem Bett liegt? All dies hat eine Menge mit dem kolonialistischen Blick zu tun. Vor Jahren kam ein alter Herr: "Das ist noch von meinem Vater, der war im Boxeraufstand", und er schenkte uns ein von einem Matrosen gesticktes Bild. Da steht oben in Rot „Zur Erinnerung an den Boxeraufstand 1900 bis 1901“ und unten „Gott mit uns“, in der Mitte sind die Flaggen der Alliierten, die an der Niederschlagung des Boxeraufstands beteiligt waren in Anlegetechnik appliziert, in der Mitte prangt der deutsche Adler.
Sie verkehrten wahrscheinlich durch ihren Vater, den Architekten Wilhelm Schlombs, auch in den Kreisen von Sammlern?
A. S.: Ja. Mein Vater und Großvater, der ebenfalls bei der Eisenbahn arbeitete, kannten von Lochow, und ich habe Hans Siegel bis zu seinem Tod häufig in Ascona besucht. Der hatte ja die Orientstiftung gegründet. Die sog. „old China hands“, die von den 1920er Jahren bis 1955 in China lebten, das waren Menschen mit einer unglaublichen Lebenserfahrung nach all dem, was sie während des japanischen Angriffskriegs und des Bürgerkriegs in China erlebt hatten. Weltläufig und offen, lernbegierig, klug, realistisch. Das war eindrucksvoll. Ich habe anlässlich dieser Ausstellung den Nachruf auf Adolf Fischer von Alfred Hagelstange, dem damaligen Direktor des Wallraf-Richartz-Museums, noch einmal gelesen. Er schreibt, der Name Fischer werde eines Tages ähnlich wie der Name von Wallraf in aller Munde sein. Es sei eine Pioniertat gewesen, diese Sammlung zusammenzutragen und uns Europäern durch das neu gegründete Museum für Ostasiatische Kunst endlich den Hochmut zu nehmen, Europa sei in Sachen Kunst der Nabel der Welt.
Das ist beim Publikum und anderen aber noch nicht angekommen.
A. S.: Nö. - Also, das war 1914 und jetzt haben wir 2018. Aber es ist fantastisch, was diese Leute damals schon alles erkannt haben. Das waren eben nicht nur die Fischers und Otto Kümmel (Gründer des Museums für Ostasiatische Kunst in Berlin), sondern auch die Kollegen von der europäischen Kunstgeschichte haben das so wahrgenommen. Spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts übte die Kunst Ostasiens einen permanenten Einfluss auf die europäische aus. Das fing in Frankreich an, wo die japanischen Farbholzschnitte in Massen eintrafen, z.B. bei Siegfried Bing, der in Paris sein Geschäft hatte und Holzschnitte an van Gogh verkaufte. Das ging mit den französischen Impressionisten los, gelangte Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland und in andere Länder. Wir haben z.B. in der Ausstellung Paul Klee und der Ferne Osten (2014/15) gezeigt, dass Klee viele Motive buchstäblich aus der japanischen Kunst übernommen hat. Das war eine Zusammenarbeit mit dem Zentrum Paul Klee in Bern. Ich finde, das gehört auch zu unseren Aufgaben, immer wieder die Einflüsse auf die europäische Kunst aufzuzeigen: Wir Europäer liegen falsch, wenn wir uns einbilden, dass sich unsere eigene Kunst vollkommen unabhängig entwickelt hätte.
Sie geben mit der jetzigen Ausstellung Alles unter dem Himmel einen Überblick über die Neuerwerbungen der letzten 40 Jahre, mit der die bestehenden Sammlungen umsichtig ergänzt wurden. Aber bei allem Behüten und Ergänzen der alten Bestände ist kein Stillstand eingetreten.
A. S.: Nein. Wir haben jetzt zum Beispiel die japanische Avantgarde-Kalligrafie von Yûichi ausgestellt - ich bin so glücklich, dass wir die kaufen konnten. Die Stücke waren Anfang der 1960er Jahre in der Galerie Rudolf Zwirner in Köln ausgestellt. Das Konvolut haben wir von Zwirner erworben. Der Kalligraf Inoue Yūichi war 1959 in der documenta II repräsentiert. Dadurch wurde Zwirner auf Yūichi aufmerksam. Nach dem Zweiten Weltkrieg dachten alle, die Abstraktion sei das "Esperanto der Kunst". Nachdem die Kunst im Faschismus so missbraucht worden war, in Deutschland, in Japan und in anderen Ländern, haben alle gedacht: Ja, die informelle Malerei und der abstrakte Expressionismus, das ist unsere Zukunft, unsere Weltsprache. Auch in den USA war das so, Jackson Pollock und das "all over painting", diese Leute wurden alle durch die ostasiatische Kalligrafie beeinflusst. Yūichi (1916-1985) und seine Generation suchten wiederum den Anschluss an die internationale Moderne. Westliche Künstler begannen, sich mit Kalligrafie zu beschäftigen. Der Maler Hann Trier zum Beispiel erzählte mir von einer eindrücklichen Begegnung mit dem Kalligrafen Morita Shiryū; die Informel-Künstler waren sehr am Pinselduktus interessiert, an der expressiven Qualität der Linie. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir die ostasiatische Kunst nicht einfach ausklammern dürfen! Wir brauchen sie, um unsere europäische Entwicklung besser verstehen zu können. Denn die Künstler waren ja offen und haben die ostasiatische Kunst niemals aus ihrem Blickfeld ausgespart.
|

Inoue Yûichi (1916–1985): Haha (Mutter), Tusche auf Papier, Japan, vor 1965, Museum für Ostasiatische Kunst Köln, A 2006,6. | Foto: Rheinisches Bildarchiv
|
Die Japaner haben ja auch die französischen Impressionisten nachgeahmt.
A. S.: Natürlich, natürlich. Wir haben in der Ausstellung auch wieder Beispiele für diese wechselseitige Beeinflussung. Ich spreche jetzt mal ganz gewagt die These aus: Wer sich mit der ostasiatischen Kunst überhaupt nicht befassen will, der KANN gar nicht verstehen, was in unserer westlichen Kunst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschehen ist. Umgekehrt kann man die westlichen Einflüsse auf die Kunst Ostasiens ebenso wenig übersehen. Deshalb ist dieses Museum so wichtig, und ich finde, dass es dementsprechend ausgestattet und gewürdigt werden sollte.
Gibt oder gab es nicht auch in Berlin ein Museum für Ostasiatische Kunst?
A. S.: In diesem Jahr des Jubiläums ist in Berlin tatsächlich etwas Unglaubliches geschehen: Am 1. Oktober 2018 trat Klaas Ruitenbeek, der Direktor des Museums für Asiatische Kunst, in den Ruhestand. Jetzt gibt es dieses Museum nicht mehr, denn es wurde inhaltlich und verwaltungstechnisch in das Humboldt-Forum eingegliedert, das unter ethnologischer Leitung steht. Dabei war es den Gründern Anfang des 20. Jahrhunderts so wichtig zu zeigen: "Es geht hier um Kunst und nicht um eine Lebenskultur oder Zivilisation im Sinne der Völkerkunde." In dieser Hinsicht spielt Ostasien eine unendlich wichtige Rolle: Als man in Europa noch auf den Bäumen saß, da gab es in China schon eine Kunsttheorie: Im 4. Jahrhundert! Herrscher sammelten da schon Kalligrafie. Zum Beispiel liegt ein berühmter Kalligraf im Sterben, der Kaiser schickt schnell einen Boten, um noch die letzten Tuschespuren von diesem Mann zu bekommen. DAS wurde als sammelwürdig angesehen, allein aufgrund künstlerischer Kriterien. Es ging eben nicht um die Hortung materieller Schätze wie Gold und Edelsteine oder so etwas. Der Kunstbegriff ist in Ostasien viel älter.
Die Kalligrafie besteht für viele nur aus Schriftzeichen, die zum Lesen und der Verständigung dienen. Die Kunst der Kalligrafie geht aber viel weiter. Könnten Sie das noch mal näher erklären?
A. S.: Die Gelehrtenmalerei ist eigentlich wie Kalligrafie, man sagt im Chinesischen, man „schreibt“ ein Bild. Der Pinselstrich, die Qualität der Linie, der Pinselduktus, all dies sind Kriterien, die aus der Kalligrafie stammen und für das „Lesen“ der Malerei Gültigkeit haben.
Das ist für Europäer vielleicht schwierig nachzuvollziehen.
A. S.: Aber man kann sich ja vieles aneignen. Wir versuchen das in unserer Vermittlungsarbeit auch immer deutlich zu machen. Für mich ist in der jetzigen Ausstellung zum Beispiel interessant zu zeigen: Es ist nicht nur der Buddhismus, der China, Korea und Japan verbindet, sondern es ist auch die konfuzianisch geprägte Literatenkultur, die als verbindendes Element fungiert (sehr schön herausgearbeitet in der Ausstellung Leidenschaften in der Kunst Ostasiens). Die Europäer können eine Menge verstehen, wenn man es erklärt. Man muss nur erst einmal darauf gebracht werden. In der Hinsicht kann man Ostasien auch nicht mit anderen Erdteilen vergleichen. In Afrika gab es in vielen Regionen religiöse Kunst, die in Stammeskulturen eingebettet war. Die Sammlerpioniere Anfang des 20. Jahrhunderts haben diese Unterschiede sehr differenziert wahrgenommen.
Die Sammler vor hundert Jahren haben die ostasiatische Hochkultur erkannt.
A. S.: Ja. Genau. Und die haben das dann auch umgesetzt, indem sie Museen für ostasiatische Kunst gründeten. Deshalb finde ich es so problematisch, wenn wir heute sagen: Wir geben unsere Deutungshoheit ab und packen alles Außereuropäische in eine Kiste mit dem Etikett „Weltkulturen“. Auf Unterscheidungen wollen wir aus Gründen der politischen Korrektheit lieber verzichten, wir behandeln alles Außereuropäische gleich und gleichwertig, das muss dann ja wohl fair und „gerecht“ sein. Ich fürchte, dass wir in Wahrheit auf das intellektuelle Niveau des 19. Jahrhunderts zurückfallen und sehr wenig von der Eigenart der ostasiatischen Kunst verstehen, wenn wir so argumentieren.
*
Das MOK ist nunmehr das einzige und letzte Museum seiner Art in Deutschland.
A. S.: Das Jubiläum dient nicht zuletzt dazu darauf aufmerksam zu machen, dass seit dem 1. Oktober dieses Jahres die Stadt Köln das einzige und letzte Museum für ostasiatische Kunst in Deutschland unterhält. Ich bin keine Politikerin, aber ich hoffe, dass Stadt, Land und Bund sich einig werden, wie dieses Haus nachhaltig in seiner Vermittlungsarbeit gefördert und gestärkt werden kann.
Meinen Sie, dass der Bund die Verantwortung mittragen würde?
A. S.: Wahrscheinlich nur ungern, aber man muss es versuchen. Es kann doch wohl nicht sein, dass in Deutschland alle Traditionen abgeschnitten werden, in anderen europäischen Städten gibt es doch auch Museen für Asiatische Kunst. Wenn sich das Land NRW regelmäßig und zuverlässig einbringen würde, wäre schon viel gewonnen. Es wäre notwendig, über einen adäquaten Etat und eine neue partnerschaftliche Struktur nachzudenken. Die Stadt Köln, die schon so viele Museen unterhält, sollte mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden. Das war für mich das entscheidende Argument, das eher ungewöhnliche 40jährige Jubiläum zu feiern. Ich wollte die Chance nutzen, denn wer weiß, wie die Welt in 10 Jahren aussieht?
Sie stehen auch nicht mit leeren Händen da, sondern haben etwas vorzuweisen.
A. S.: Ich habe viel am Bestand gearbeitet und zahlreiche Bestandskataloge erstellt. Die Strategie war international anerkannte Topwissenschaftler einzubinden, wie z.B. Matthi Forrer, der die Holzschnittsammlung für die Ausstellung Das gedruckte Bild - Die Blüte der Japanischen Holzschnittkultur aufgearbeitet hat, oder wie die Aufarbeitung der Sammlung japanischer Malerei durch Doris Croissant. Die Publikation unserer Bestände ist ein Muss, ein Zwang unserer Zeit, dazu gehört natürlich auch die Bereitstellung und Dokumentation in der Bilddatenbank „Kulturelles Erbe Köln“ (KEK). Das sind sehr wichtige Weichenstellungen.
Sind die Japaner derzeit in der Lage, das MOK zu unterstützen?
A. S.: Bei den Gemälderestaurierungen haben wir sehr viel Unterstützung von Seiten der japanischen Denkmalbehörde National Research Institute for Cultural Properties sowie von der Sumitomo Foundation erhalten. Außerdem findet jedes Jahr im Herbst ein Lack-Workshop für Restauratoren im MOK statt. Wir versuchen nicht nur, den Anforderungen gerecht zu werden, die von Seiten der Verwaltung und der Besucher an uns gestellt werden, wir wollen und müssen auch die Kontakte in die ostasiatischen Länder kontinuierlich warm und frisch halten, Anträge stellen, Anfragen beantworten usw. Im Januar kommenden Jahres leihen wir die riesige Bronzeplastik der Usagi-Kannon (700 kg) von Leiko Ikemura nach Tokyo zu einer monografischen Ausstellung im Nationalmuseum für Moderne Kunst aus. Ich empfinde das als Ehre, vielleicht rüttelt diese Nachricht manche Menschen auf, dass sie sehen, hier gibt es ein außergewöhnliches Museum, das auch in den Ländern Ostasiens wahrgenommen und geschätzt wird. Wir haben ein Juwel, das wir bewahren wollen.
|

Museum für Ostasiatische Kunst Köln, Raumaufnahme Buddhismus | Foto (C) Lothar Schnepf, Köln
|
Woher kommt diese Nicht-Wertschätzung eigentlich?
A. S.: Also das ist eine Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann, aber es ist leider noch immer ein Fakt. In der Ausstellung zeigen wir zum Beispiel ein Konvolut Exportporzellan, weil im 17. und 18. Jahrhundert eine große China-Begeisterung an den europäischen Fürstenhöfen herrschte. China, das Reich der Beamtenprüfungen und der konfuzianischen Meritokratie war im 17. und 18. Jahrhundert eines der reichsten und aufgeklärtesten Länder der Welt. (Davon zeugte z.B. die Ausstellung im MOK Glanz der Kaiser von China 2012/13.) Im 19. Jahrhundert blieb im Zuge des Kapitalismus von dieser Bewunderung nicht viel übrig. Die Kolonialmächte teilten das Riesenreich in Interessensphären auf. Wir sehen dann, welche Nicht-Wertschätzung der kolonialistische Blick eigentlich beinhaltet.
Sie schaffen es immer wieder, wunderbare Ausstellungen aus den eigenen Beständen zu zaubern.
A. S.: Wir haben wirklich einen sehr interessanten Fundus. Ich glaube, in der Zukunft wird es noch mehr auf die eigene Sammlung ankommen. Wenn Sie eine gute Sammlung haben, können Sie aus dem Fundus etwas kreieren, dazu noch wenige gezielte Leihgaben, und Sie haben eine tolle thematische Ausstellung. In den letzten Jahren hat sich die Bürokratie verfünffacht oder sogar verzehnfacht - wenn Sie heute etwas ausleihen wollen, ist das ein Mords-Aufwand, und es wird immer teurer. Wir haben unzählige Genehmigungsverfahren, auf allen Ebenen wird es immer komplizierter. Wo früher drei Menschen korrespondiert haben, sind es heute 30. Dass die Sache dadurch nicht billiger wird, liegt auf der Hand. Es ist auch unstrittig, dass kein Kunstwerk besser wird, wenn es im Landeanflug kräftig durchgeschüttelt wird. Wer realistisch ist, muss erkennen, dass Blockbuster-Ausstellungen wegen der steigenden Kosten in der Zukunft immer schwieriger zu realisieren sein werden. Auch die Museen sind viel vorsichtiger geworden, denn mit Hilfe digitaler Techniken lassen sich heute Schadensbilder nachweisen, von denen man früher noch nicht einmal geträumt hätte.
Durch die Datenbanken hat sich der Aufwand natürlich merklich erhöht.
A. S.: Die Digitalisierung hat neue Möglichkeiten geschaffen, mehr über die Bestände herauszufinden und sie global zugänglich zu machen. Deswegen glaube ich, dass der Stellenwert der eigenen Sammlung steigen wird. Aber sie muss gut betreut werden, sie muss gut aufgearbeitet werden, dann haben Sie eine große Spielwiese, mit der Sie hervorragend arbeiten können. Ich stelle fest, dass durch die Pflege der Bilddatenbanken viel mehr Personal benötigt wird. Dabei geht es nicht nur um Wissenschaftler, Sie brauchen auch effizient arbeitende, gut ausgebildete Menschen, die das vorhandene Wissen systematisch einarbeiten. Das ist ein unheimlich großes Arbeitsfeld. Wir benutzen in unserem Haus noch immer für viele Bereiche die in Sütterlinschrift geschriebenen Karteikarten der Ära Fischer. Die Digitalisierung kostet viele, viele Mannjahre. Es genügt auch nicht, die Inhalte der alten Karteikarten einfach nur zu übertragen, denn unser Wissen hat sich enorm weiterentwickelt.
Sie haben noch etliche Ideen für Projekte in der Zukunft.
A. S.: Ein großes und wichtiges Desiderat ist die Aufarbeitung der chinesischen Literatenmalerei und der Bronzen. Ich habe immer gedacht, dass ich das noch vor meiner Pensionierung schaffen könnte. Die buddhistische Malerei vor allem Japans wäre auch noch ein Wunschprojekt. Der Katalog zur buddhistischen Skulptur und Plastik ist mittlerweile veraltet und müsste neu bearbeitet werden. Aber vor allem hoffe ich, dass ich noch eine große Sonderausstellung mit Leihgaben verwirklichen kann. Mir schweben die exzentrischen Maler der Edo-Zeit vor, wirklich atemberaubend – und es wäre doch nicht schlecht, den Zeitgenossen in unserer zunehmend durch und durch verwalteten Welt zu zeigen, dass das Zulassen von Exzentrik für die Entstehung kreativer Ideen sehr wichtig sein kann.
Heute ist Nikolaustag. Sie dürfen sich etwas wünschen.
A. S.: Ich würde mir wünschen, dass das Museum eine zuverlässige und regelmäßige Unterstützung durch das Land NRW erhält. Wir brauchen ein solides Rückgrat, um eine Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Das würde ich mir wünschen. Ich selbst werde davon ja nicht mehr viel profitieren, aber meine Nachfolger.
Was könnte die Stadt Köln da tun?
A. S.: Sie könnte mit dem Land NRW in Verhandlungen eintreten, und sie könnte zusammen mit mir eine Konzeption oder einen maßgeschneiderten Vorschlag ausarbeiten. Ich denke schon, dass unsere Oberbürgermeisterin damit Gehör finden würde.
Danke für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen und dem MOK alles Gute.
[Das Gespräch fand am 6. Dezember 2018 statt.]
|
Interviewerin: Helga Fitzner - 14. Dezember 2018
ID 11100
Dr. Adele Schlombs studierte Sinologie sowie ostasiatische und europäische Kunstgeschichte und vergleichende Religionswissenschaft an den Universitäten Köln und Heidelberg. Von 1977-78 studierte sie in Taiwan, von 1984 bis 87 war sie in Japan und studierte an der Universität Kyoto.1989 folgte die Promotion zu einem exzentrischen Mönchskalligrafen des 9. Jahrhunderts in Heidelberg. Im Jahre 1991 übernahm sie die Leitung des Museums für ostasiatische Kunst in Köln, das sie seitdem behütet und voranbringt, um seine Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten.
Weitere Infos siehe auch: http://museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/
Post an Helga Fitzner
Interviews
Museen im Check
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUSSTELLUNGEN
BIENNALEN | KUNSTMESSEN
INTERVIEWS
KULTURSPAZIERGANG
MUSEEN IM CHECK
PORTRÄTS
WERKBETRACHTUNGEN
von Christa Blenk
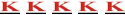
= nicht zu toppen
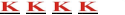
= schon gut
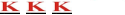
= geht so

= na ja

= katastrophal
|