 Weil nicht sein kann, was nicht sein darf
Weil nicht sein kann, was nicht sein darf
|
Zu den idiotischsten Floskeln des an Phrasen nicht armen gegenwärtigen Sprachgebrauchs gehört der Halbsatz „es kann nicht sein“. Die damit eingeleiteten Bekundungen über Zustände und Vorgänge sind leeres Gerede, da, was angeblich nicht sein kann, doch ist. 2022 tönte Joschka Fischer: „Es kann nicht sein, dass der Krieg auf europäischen Boden zurückkehrt.“ Da hatte der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine längst begonnen, und schon zuvor war der Krieg an mehreren Stellen nach Europa zurückgekehrt. Noch heuer erklärte die Ärztin Dr. Jenny De la Torre Castro: „Es kann nicht sein, dass ein Menschenleben vom Geld abhängt.” Genau das aber ist der Fall. Menschenleben können nicht nur vom Geld abhängen, sie tun es tatsächlich, Tag für Tag, wenn eine Behandlung „zu teuer“ oder das zu erwartende Einkommen bei Überleben zu niedrig ist. Und die estnische Politikerin Kaja Kallas bemerkte, ebenfalls im Jahr 2025: „Es kann nicht sein, dass Russland die ukrainischen Gebiete bekommt, die USA die Bodenschätze und Europa die Zeche zahlt für die Friedenssicherung.“
Sie alle und Hunderte mehr haben Probleme mit Hilfszeitwörtern. Was sie sagen wollen, ist: Etwas soll oder darf nicht sein. Sie kleiden ein Postulat in eine Tatsachenbehauptung und suggerieren damit eine Machtposition, über die sie nicht verfügen. Sie können nicht darüber entscheiden, ob etwas sein kann oder nicht. Aber ihre Einsicht in die eigenen Grenzen ist noch geringer als die Beherrschung der Grammatik. Indem sie freilich behaupten, dass etwas nicht sein könne, was in Wirklichkeit ist, verzerren sie diese Wirklichkeit, geben sie falsche Auskünfte, die im schlimmsten Fall genau das bewirken, was sie verbieten wollen.
Man spitze die Ohren, wenn ein Satz mit den Worten „Es kann nicht sein“, vorgetragen meist im unbeirrbaren Brustton der Überzeugung, beginnt. Wer so daherschwafelt, lügt meistens auch oder gibt zumindest vor, eine Wahrheit zu kennen, die anderen verborgen ist. Schickt ihn oder sie zum Teufel. Es kann leider sein (!), dass sie mit ihrer Sprachschlamperei Schaden anrichten.
|
Thomas Rothschild - 6. Juli 2025
2810
|
 Theodor Kramer
Theodor Kramer
|
Erich Fried und Hilde Spiel schätzten ihn beide sehr. 1897 geboren, war der 24 bzw. 14 Jahre ältere Theodor Kramer Senior unter den österreichischen Dichtern, die vor den Nationalsozialisten nach England fliehen mussten. Er hatte sich schon einen Namen gemacht, ehe er ins Exil gejagt wurde, mehr noch: er gehörte zu den populären und meist gelesenen österreichischen Dichtern der Zwischenkriegszeit.
Die metrisch regelmäßigen, strophisch gegliederten und gereimten Gedichte Kramers bieten sich einer Vertonung an. Kramer selbst hat angeregt, dass seine Verse vertont werden sollten. Das Duo Zupfgeigenhansel - Erich Schmeckenbecher & Thomas Friz - hat schon 1985 eine erfolgreiche LP mit Liedern zu Texten von Theodor Kramer aufgenommen, der in der DDR sozialisierte Liedermacher Wenzel sang fast gleichzeitig Texte des um seine Heimat betrogenen Dichters und zog 1997 mit einer Kramer-CD nach. Weitere Aufnahmen gibt es von Heike Kellermann und Wolfgang Rieck, von Thomas Riedel und Hubertus Schmidt, von Harald Hahn, David Fuhr und Georg Siegl. Diese Häufung verdankt sich einmal dem bei jungen Künstlern nach 1968 erwachten Interesse für das Exil in den Jahren des Nationalsozialismus, dann aber eben auch der Liedhaftigkeit von Kramers Gedichten.
Beeindruckend ist der Umfang von Kramers Werk. Die dreibändige Ausgabe der Gesammelten Gedichte umfasst mehr als 2.000 Seiten, der unermüdliche Herausgeber und Nachlassverwalter Erwin Chvojka spricht von insgesamt rund 12.000 Gedichten. Kramer, der 1958, also mit 61 Jahren, starb, ist in seiner Dichtung noch ganz ein Kind des 19. Jahrhunderts. Man findet bei ihm zuhauf Motive, die auf die Romantik und weiter zurück verweisen, Landschafts- und Naturbilder, Liebesgeständnisse, Selbststilisierungen der Rastlosigkeit und des Umherirrens, anakreontische Huldigungen an den Wein. Der Vierzeiler Motto benennt stichwortartig die thematische Brennpunkte, die sich durch Theodor Kramers Werk ziehen: den „Braten“, den „Rotwein“, den „Schwarzen“ (also den Mokka, wie man ihn in Wien bestellt), die Liebe, das „Sinnen“, den „Schritt“ und das scharfe „Wort“. Kramers Metaphern sind unmittelbar verständlich, weit entfernt von der Hermetik des 23 Jahre jüngeren Paul Celan, aber auch vom exaltierten Expressionismus des 10 Jahre älteren Trakl. Manchmal schleicht sich ein ironischer oder mild humoristischer Ton ein, häufiger macht sich eine sentimentale oder auch depressive Stimmung bemerkbar, die sich nur zum Teil der Lebenssituation des Dichters verdankt. So wird bei Kramer aus Arthur Schnitzlers Motiv der Frau, die sich – in Spiel im Morgengrauen – für eine weit zurückliegende Demütigung rächt, indem sie den verschuldeten Leutnant Kasda nach einer Liebesnacht bezahlt, in einem Rollengedicht eine romantisierende Männerfantasie, wenn er die „Vorstadthure“ davon träumen lässt, dass sie einen, „der schlechter daran ist und ärmer als“ sie, mit sich aufs Zimmer nähme, um ihm morgens „einen Schein“ zurückzulassen.
In den Gedichten Theodor Kramers, den es aus dem Weinviertel, aus Niederhollabrunn, nach Wien verschlug, finden sich zu einer Zeit, da die Großstadt auch in der Literatur zu einem zentralen Thema wird, immer wieder Spuren der ländlichen Herkunft. Wie zahlreiche Schriftsteller seiner Generation sympathisiert er mit den „kleinen Leuten“, macht er ihre Lebenssituation beschreibend oder simulierend zum Gegenstand seiner Gedichte. Auch das lässt Kramer für heutige Liedermacher attraktiv erscheinen. Lieder von Vaganten und Außenseitern gehörten seit den sechziger Jahren zu ihrem bevorzugten Repertoire, als Ahnen betrachteten sie Villon oder Carl Michael Bellman. Da passt Theodor Kramer gut hinein.
In Österreich war man an Theodor Kramer nach dem Krieg ebenso wenig interessiert wie an all den anderen ins Exil Verjagten. Man könnte das auf den doch etwas veralteten Stil zurückführen, wären nicht zur gleichen Zeit noch viel altmodischere Lyriker hochgepriesen und geehrt worden, wäre nicht zur gleichen Zeit die Avantgarde, jedenfalls im Zentrum des Literaturbetriebs, marginalisiert worden. Nein, an der Form der Gedichte hat es nicht gelegen. 1957 holte man Theodor Kramer nach Wien zurück. Das Exil hatte zwölf Jahre länger gewährt als der Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich. Nicht verwunderlich, da doch der damalige sozialdemokratische Innenminister Oskar Helmer mit unverhohlener Abscheu „überall nur jüdische Ausbreitung“ registrierte und der sozialdemokratische Präsidentschaftskandidat just in diesem Jahr mit dem Slogan „Wer einmal schon für Adolf war, wählt Adolf auch in diesem Jahr“ warb – mit Erfolg, wie man weiß. Theodor Kramer hat die Heimkehr gerade um ein halbes Jahr überlebt. Die Missachtung aber hält an. Für Bruno Kreisky zählte Theodor Kramer noch „zu den großen literarischen Erlebnissen meiner Jugend“. Und Kreisky ergänzt: „Auch die Mühlen der literarischen Gerechtigkeit mahlen langsam.“ Seit Kreisky dies schrieb, sind 42 Jahre ins Land gezogen. Die Mühlen mahlen immer noch.
|
Thomas Rothschild – 14. April 2025
2807
|
 Mein Lieblingswort
Mein Lieblingswort
|
„Harakiri“ ist, in übertragener Bedeutung, ins Deutsche eingegangen („Harakiri begehen“), weil es kein deutsches Wort dafür gibt. „Selbstmord“ oder „Freitod“ entbehren der Konnotation, dass es sich um einen freiwilligen Tod nicht aus Lebensüberdruss, nicht als Folge von Depressionen geht, sondern als Konsequenz eines übersteigerten Ehrbegriffs und zudem als Teil eines vorgeschriebenen, uns hier und heute exotisch scheinenden Rituals. Wenn sich jemand, wie etwa Leutnant Gustl, in unserem Kulturraum wegen eines vermeintlichen Ehrverlusts erschoss, gab es für diesen Akt kein eigenes Wort (wie für das damit verwandte Ritual des „Duells“, das sich vom „Zweikampf“ unterscheidet). Zudem gefällt mir „Harakiri“ wegen seiner phonetischen Qualität. Innerhalb des deutschen Lautsystems wirkt das Wort durch den doppelten Binnenreim komisch, obwohl es einen tragischen Vorgang bedeutet. Es erinnert an Wörter wie „Larifari“ oder „Vitzliputzli“ (Heine). Damit kann kein „Sputnik“, kein „Telefon“ und kein „Spaghetti“ konkurrieren.
Die vor 18 Jahren verstorbene Lyrikerin Heidi Pataki hat ein Gedicht mit dem Titel harakiri geschrieben. Es beginnt mit einem Ausruf, dem ô mit Zirkumflex, auf den der „sinnlose“ Zweisilber „hara“ folgt, also der Anfang des Wortes „Harakiri“. Zusammen mit dem o aber ergibt das den irischen Namen O’Hara, den wir zum Beispiel von Maureen O’Hara kennen, der Esmeralda aus William Dieterles berühmter Verfilmung des Glöckners von Notre Dame. Noch im ersten Vers taucht das Verb „kikerikiet“ auf, das mit dem Wort „Harakiri“ nichts verbindet außer einer phonetischen Verwandtschaft. Dieses Vorrücken auf der Basis klanglicher Ähnlichkeit setzt sich fort in der Nachbarschaft „flausen zaust“ und dem Reim „ausgelaust“. Man denkt an die Lust an Schüttelreimen, die in der Zwischenkriegszeit wie eine Epidemie weniger die ernsthafte Literatur als die Kabaretts überfiel. Die Konsonanten k und r und die Vokale a und i aus „Harakiri“ kehren wieder in den folgenden Reimwörtern „kleinkariert“ und „karikiert“. Dann aber wird tatsächlich auf die Bedeutung von „Harakiri“ rekurriert, nur um eine nachvollziehbare, wenn auch abstruse Situation – es fehlen das Krummschwert und ein Bauch, der zum Chinesen fand („Alle Kineser san Japaner“, stellt Karl Kraus in den Letzten Tagen der Menschheit fest) – nur um diese Situation also in eine Metapher umzubiegen: „stürz dich [statt ins Schwert, müssen wir ergänzen] ins wort“.
|
Thomas Rothschild - 12. Juni 2024
2794
|
 Experiment und Erzählen
Experiment und Erzählen
|
Experiment und Erzählen sind keine einander ausschließenden Kategorien. Man kann experimentell und konventionell erzählen, und man kann narrativ und nicht-narrativ experimentieren. Lawrence Sterne und James Joyce, Dos Passos und Michel Butor haben mit dem Erzählen experimentiert. Umgekehrt gibt es Sprachspiele – etwa in Kinderversen oder in der Werbung –, die bloße Reproduktion, keineswegs Experimente sind.
Die Zuspitzung der scheinbaren Alternative von Erzählen und Experiment ist ein spezifisch österreichisches Phänomen. Sie hängt zusammen mit dem besonderen Stellenwert der Wiener Gruppe in der Nachkriegszeit. Diese musste ihre Positionen polemisch pointieren, um gegen den Konservatismus eines herrschenden, am 19. Jahrhundert orientierten Erzählens anzukommen. Der scheinbare Kampf um ästhetische Standpunkte war in Wahrheit auch ein politischer Kulturkampf, der Versuch einer jüngeren Generation, sich in der Konkurrenz gegen jene zu behaupten, die ihre ersten schriftstellerischen Schritte als Nazis oder als Klerikalfaschisten gemacht und in der Zweiten Republik in Gremien und Organisationen wieder das Sagen hatten. Experiment hieß damals für seine Verfechter auch Öffnung zur Weltliteratur und insbesondere zu künstlerischen Verfahren, nicht nur in der Literatur, die von den Nationalsozialisten mit nachhaltiger Wirkung als entartet diffamiert wurden.
Wenn man sich die Definition des tschechischen Philosophen Jan Mukařovský zueigen macht, wonach sich Literatur von anderen sprachlichen Kommunikationssystemen dadurch unterscheide, dass in ihr die ästhetische Funktion vor allen anderen Funktionen – etwa der Mitteilung, der Aufforderung, der Überredung etc. – den Vorrang habe, dann wäre eine Literatur, die auf ihre Materialität verweist, anstatt der erzählenden Wiedergabe einer scheinbar außerhalb der Literatur bestehenden Wirklichkeit zu dienen (was freilich eine Täuschung ist), gleichsam „literarischer“ als diese – wenn man denn überhaupt eine Hierarchie des Literarischen erstellen kann. Versuche einer entsprechenden Quantifizierung, etwa im Umkreis von Max Bense, sind ja bekanntlich gescheitert.
Anstatt weiterhin emphatisch zu behaupten, nur das, was man selbst betreibe – das Erzählen einer Fabel oder das Spiel mit dem selbstwertigen Wort –, sei „eigentlich“ Literatur, sollte man sich klarmachen, dass hier ein terminologisches und daher nur durch Setzung lösbares Problem als ontologisches ausgegeben wird. Aus dem scheinbaren Widerspruch zwischen dem, was vereinfachend mit Erzählen und mit Experiment bezeichnet wird, gibt es zwei mögliche Auswege. Entweder man betrachtet Erzählen und Experiment als zwei verschiedene Möglichkeiten von Literatur, wobei man dann darüber streiten kann, wie grundsätzlich die Unterschiede sind, ob und wo es Schnittmengen und Mischformen gibt; oder man führt neben „Literatur“ einen zweiten Begriff ein und nennt nur das Erzählen oder nur das Experiment Literatur, das andere aber anders, wie man ja auch Theater und Tanz unterscheidet, obwohl in beiden Fällen menschliche Körper auf einer Bühne agieren und historisch gesehen Theater und Tanz einmal als eins betrachtet wurden. Dass sie im heutigen Tanztheater wieder zusammenfinden, zeigt nur, wie die Geschichte manche Unterscheidung überflüssig macht. Vielleicht ist das auch eine Perspektive für die Literatur und den scheinbaren Gegensatz von Erzählen und Experiment.
|
Thomas Rothschild - 30. Mai 2024
2793
|
 Der Sachverständige
Der Sachverständige
|
Wenn in den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, im Fernsehen über die Sowjetunion und den Marxismus diskutiert wurde, durfte er nicht fehlen: Wolfgang Leonhard. Er galt neben Pater Wetter, mit dem zusammen er ein Standardwerk über Sowjetideologie verfasst hat, als der beste Kenner der Materie. Dabei wurde geflissentlich übersehen, dass Leonhard zwar frühzeitig mit der Sowjetunion, nicht aber mit dem Marxismus gebrochen hatte. Er war einer der leidenschaftlichsten Anhänger Titos, und die Tatsache, dass Titoisten nach dem Bruch der UdSSR mit Jugoslawien für orthodoxe Kommunisten schlimmere Feinde waren als die Apologeten des Kapitalismus, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch sie einen Sozialismus befürworteten – freilich nach einem anderen Modell als jenem, das die Sowjetunion anbot. Wolfgang Leonhard war ein Häretiker, aber kein Renegat, und bekanntlich hassen Religionen niemanden so sehr als eben die Häretiker.
Wolfgang Leonhard hatte von seiner Biographie her weit mehr mit dem Kommunismus zu tun als viele, die ihn bekämpften. Seine Mutter war Susanne Leonhard, von Jugend an und bis zu ihrem späten Lebensende im Jahr 1984 Kommunistin, obgleich sie schon 1925 die Partei verließ und zwölf Jahre in einem sibirischen Lager verbracht hatte. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten emigrierte der 1921 geborene Wolfgang Leonhard, dem seine Mutter den eigentlich verräterischen Vornamen Wladimir gegeben hatte, zunächst nach Schweden und 1935 in die Sowjetunion. Noch vor Kriegsende, an dem Tag, an dem Hitler sich das Leben nahm, zog Leonhard nach Berlin, wo er der Gruppe Ulbricht angehörte. Seit 1950 arbeitete und lehrte er in der Bundesrepublik und in den USA. Er ist vor knapp zehn Jahren, ,am 17. August 2014 im Alter von 93 Jahren gestorben.
Heute, da sich jede und jeder ohne Verstand und Kenntnisse über Putin äußert, da differenzierte Analysen und Erklärungen nötiger wären denn je, fehlt eine öffentliche Figur wie Wolfgang Leonhard mehr denn je.
|
Thomas Rothschild - 20. Mai 2024
2789
|
 Geheimwissen
Geheimwissen
|
Im Internet existiert eine, wie man annehmen darf, von den Pflichtgebührenzahlern finanzierte, Aussprachedatenbank. für deren Verwendung man sich registrieren lassen muss. Versucht man das bei der angegebenen Adresse, erhält man folgende Antwort: "Der Zugriff auf die Aussprachedatenbank ist beschränkt auf den internen Gebrauch und aktuell nur für Mitarbeitende der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten möglich." Mit anderen Worten: Die richtige Aussprache, vorausgesetzt, die Datenbank ist korrekt, bleibt Geheimwissen. Oder wahrscheinlicher: Der ganz normale Staatsbürger soll nicht in die Lage versetzt werden, zu überprüfen, ob Mitarbeitende der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Wörter und Namen, zumal aus Fremdsprachen, richtig aussprechen.
Unter uns Pfarrerstöchtern: Sie tun es nicht. Polnische Namen beispielsweise werden regelmäßig falsch ausgesprochen. Offenbar haben die Mitarbeitenden der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, mit oder ohne Aussprachedatenbank, noch nicht einmal begriffen, dass der Wortakzent im Polnischen in der Regel auf der vorletzten Silbe liegt (im Gegensatz etwa zum Tschechischen oder zum Ungarischen, wo auf der ersten Silbe betont wird), und dass man sich bei russischen Eigennamen, wo es solch eine Regel nicht gibt, besser erkundigen sollte. Unsere neuen ukrainischen Mitbürger*innen können da zuverlässig Auskunft geben, ohne dass man sich registrieren lassen muss. Nicht jede Russin, deren Name auf -aja endet, will auf der vorletzten Silbe betont werden, als wäre sie eine Polin. Sie hat den gleichen Anspruch auf korrekte Aussprache wie Biden, Kissindscher oder, neuerdings, sogar Erdoğan.
Unlängst hat die putzige Evelin König in der noch putzigeren Vorabendsendung ARD-Büffet "schegediner Gulasch" statt "segediner Gulasch" empfohlen, weil sie das ungarische "sz" offenbar nicht vom polnischen unterscheiden kann oder nicht weiß, wo Szeged liegt. Dabei hätte sie Zugang zum Geheimwissen. Sie kann mit einer "E-Mail-Adresse der Rundfunkanstalten der ARD oder einer der folgenden Rundfunkanstalten: ZDF, Deutschlandradio, ORF, Rai Südtirol, SRF, RTR, ARTE und radio 100,7" einen Registrierungs-Code beantragen, und husch, kommt die (hoffentlich) richtige Aussprache ins Haus.
Ob die ARD und ihre Affiliationen mit den Daten für die Kontaktierung säumiger Gebührenzahler ebenso klandestin umgehen wie mit den Daten derer, die wissen wollen, wie man „klandestin“ ausspricht?
|
Thomas Rothschild - 5. März 2024
2787
|
 Satzstellung
Satzstellung
|
In der Online-Dependance der ZEIT, des Wochenblatts für das gebildete Bürgertum, kann man in einem Interview den folgenden Satz lesen: „Als Frau ist das dann eben ein unangenehmer Arbeitsort.“ Der Arbeitsort – in diesem Fall: ein Schiff – als Frau? Gibt es niemanden, der als ZEIT-Redakteur stillschweigend verbessert: "Für eine Frau ist das dann eben ein unangenehmer Arbeitsort"? Wozu auch? Als Leser ist Stummeldeutsch gut genug.
Zwei Tage später kommentiert eine Nutzerin auf nachtkritik.de: „Ihr macht echt super tolle Arbeit und als Studentin der Kultur- und Theaterwissenschaften seid ihr echt unentbehrlich für mich!“ Das Lob ist echt super toll in Ordnung, auch wenn die Angesprochenen, nämlich das Redaktions-Team, keine Studentin der Kultur- und Theaterwissenschaften sind, der Satz ist es nicht. Vielleicht sollte man an den Universitäten, an denen Kultur- und Theaterwissenschaft gelehrt werden, Kurse für korrektes Deutsch einrichten und die Redakteure der ZEIT gleich dazu einladen.
Die Regeln für die Wortstellung im Satz sind in verschiedenen Sprachen unterschiedlich. Fürs Deutsche sind sie vergleichsweise streng. Wenn man sie ignoriert, verändert das den Sinn oder erzeugt Unsinn. „Sogar die ZEIT kocht mit Wasser“ ist eine andere Aussage als „Die ZEIT kocht sogar mit Wasser“. Dass die Missachtung von Regeln Verwirrung schafft, gilt sogar für die aus dem Schriftbild nicht erschließbare Betonung. „Heute so und morgen so“ hat entgegengesetzte Bedeutung, je nachdem ob man „heute“ und „morgen“ oder ob man, beide Male, „so“ betont. Die zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber der Grammatik (gegenüber dem Stil, über den man streiten kann, sowieso) ist nicht bloß ein ästhetisches Problem. Sie torpediert eine Kommunikation, die die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen verringert. Wohlgemerkt: ich spreche nicht von Einwanderern. Sie verdienen jede Geduld und jedes Nachsehen. Ich spreche von Frauen und Männern mit Deutsch als Muttersprache, zu denen man ZEIT-Redakteure und eine Studentin der Theaterwissenschaft mit einem unverkennbar deutschen Namen wahrscheinlich rechnen darf.
Aber ich weiß schon, dass mein Unbehagen nichts ändern wird und dass es vielen kleinlich erscheint. Damit habe ich mich abgefunden. Als habitueller Pessimist. Oder sollte ich sagen: Der gegenwärtige Umgang mit Sprache ist als Pessimist für mich beklagenswert?
|
Thomas Rothschild - 23. November 2023
2783
|
 Ironie
Ironie
|
Was die Sozialisation im Elternhaus so ausmacht! Meine Mutter hatte einen ausgeprägten Hang zur Ironie, manchmal bis hin zum (verletzenden) Spott. Mein Vater, eher zu rationalen Erklärungen neigend, benützte in seiner Rede nur selten Ironie, aber er hatte keine Probleme, sie zu erkennen, zu verstehen und zu genießen.
Meine eigene Haltung ist entschieden ironisch. Damit verbunden ist eine Idiosynkrasie gegenüber Pathos, halbverstandenen Phrasen oder Selbstüberschätzung. Ich kann nicht anders, als im ernst Gemeinten auch das Lächerliche zu erkennen. Wer aber Ironie äußert, riskiert, missverstanden zu werden. Mehr noch: er wird meistens außerhalb des Kreises, der ihn sehr gut kennt und seine Werte womöglich teilt, missverstanden. Ironie ist kommunikatives Glatteis.
Ich hatte einen guten Freund, der über eine große Zahl von charakterlichen und intellektuellen Vorzügen verfügte. Ironie allerdings gehörte nicht dazu. Wenn ich ihm gegenüber eine ironische Bemerkung machte, antwortete er darauf mit todernsten, oft in lange Vorträge ausartenden Belehrungen. Ich habe also versucht, mich zu zügeln und Ironie im Umgang mit ihm zu vermeiden. Er ist nicht der Einzige in meinem engeren und entfernteren Bekanntenkreis, dessen ironische Anlage mit ihrer analytischen Begabung nicht Schritt halten kann.
Ich muss allerdings gestehen, dass mir eine ironiefreie Kommunikation ziemlich ermüdend erscheint. Sie ist mit der Humorlosigkeit verwandt. Es ist oft viel einfacher, das Gegenteil vom Gemeinten zu sagen, wenn das denn auch verstanden wird, als das Gemeinte ausführlich zu begründen. Auch in der Literatur und selbst in der politischen Propaganda liest sich intellektuelles Florett in der Regel angenehmer als rhetorischer Kanonendonner.
Dagegen ließe sich bei genauerer Betrachtung einwenden: Ironie ist die Sprechweise der Mächtigen oder – da diesen meist nur eine sehr eingeengte Sprache zur Verfügung steht – derer, die den Mächtigen artikulatorisches Begleitfeuer liefern. Man muss schon „darüberstehen“, gefahrlos hinabblicken können auf das, was man ironisch der mehr oder weniger wohlwollenden Ridikülität preisgibt.
Den Machtlosen bleibt anstelle der Ironie nur der Spott. Er ist die Notwehr der Unterlegenen. Seit es Literatur gibt, gibt es auch den Spott über Institutionen und deren Repräsentanten. Wenn man die Verhältnisse der Ungleichheit und der Unterdrückung schon nicht beseitigen kann, so will man sie wenigstens grimmig verlachen, vornehmlich im Hinterstübchen, weil es sonst den Kopf kosten könnte. Spottverse und Lieder, Witze und Zoten über Fürsten und Kirchenvertreter haben eine lange Tradition. Der Spott gilt als plebejisch (und ist es auch oft). Er hat daher schlechte Presse und in den Feuilletons kaum seinen Platz. Die bevorzugen die Ironie, weil sie sich ja auch lieber auf die Seite der Mächtigen als auf die der von diesen Eingeschüchterten stellen.
Wo aber die Gefahr lebensbedrohlich wird, da greifen weder Ironie noch Spott, da herrscht notgedrungen absolute Humorlosigkeit. Ironie und Spott sind dem mörderischen Mob nicht adäquat. Ästhetisch ist ihm nicht beizukommen. Ironie funktioniert nicht, wo Entsetzen waltet. Und übrigens – da berühren sich die Extreme – auch nicht bei Begeisterung. Wir werden, wie die Zeichen stehen, für einige Zeit das Feld wohl den Zynikern überlassen müssen.
Einer der größten Ironiker, Karl Kraus, schrieb 1933: „Mir fällt zu Hitler nichts ein.“ So weit sind wir noch nicht. Aber gar weit entfernt auch nicht, wo sich ein Björn Höcke und seine Anhänger und Wähler anschicken, die Demokratie mit demokratischen Mitteln (der neue Faschismus braucht keinen Putsch) abzuschaffen.
|
Thomas Rothschild - 16. August 2023
2781
|
 Mogelpackung
Mogelpackung
|
Die Stiftung Warentest benennt in jeder Nummer ihrer Zeitschrift Mogelpackungen, Waren also, deren Verpackung einen größeren Inhalt vortäuscht, als tatsächlich drin ist. Es wäre an der Zeit, solche Enthüllungen auch für den Buchmarkt zu veröffentlichen.
In vergangenen, moralischeren Zeiten enthielten die Ausführungen auf den Buchhüllen oder -umschlägen, die sogenannten Klappentexte, tatsächlich Informationen, die dem Besucher eines Buchladens bei der Auswahl seiner Lektüre und der Entscheidung für oder gegen einen Kauf behilflich sein sollten. Heute kann man kaum noch ein Buch zur Hand nehmen, auf dessen Verpackung nicht beteuert wird, dass sein Autor „einer der bedeutendsten Schriftsteller“ sei. Wo es aber nur noch bedeutendste Schriftsteller oder Schriftstellerinnen gibt, bedeutet dieses Label gar nichts. Es gehört zum Vokabular von Werbefachleuten, die die Bücher, die sie anpreisen, wahrscheinlich nie gelesen haben.
Gerne drucken die Verlage im Klappentext auch Urteile – ausschließlich positive, überschwängliche versteht sich – von Kolleg*innen des Verfassers, der Verfasserin ab. Diese beruhen auf dem Manuskript oder, meist verschleiert, auf vorausgegangenen Publikationen. Auf welchem Weg und unter welchen Bedingungen sie vor Drucklegung zum Verlag gelangt sind, kann man nur erraten.
Schon in den vergangenen Jahren prangte auf Umschlägen von zweiten und weiteren Auflagen die auffällige Kennzeichnung eines SPIEGEL-Bestsellers. Inzwischen annonciert sie einen „SPIEGEL-Bestseller-Autor“. Abgesehen davon, dass man darüber streiten kann, was es über die Qualität eines Buchs besagt, dass es sich gut verkauft hat (auch ein Hamburger von McDonald’s ist ein Bestseller): dass ein Autor einen Bestseller geschrieben hat, heißt noch nicht, dass er das wiederholt. Die Literaturgeschichte kennt unzählige Schriftsteller*innen, bei denen auf einen großen Wurf eine Pleite folgte.
Am 23. August kommt bei Luchterhand ein Bändchen des auf Bestseller abonnierten Ferdinand von Schirach mit dem Titel Regen heraus. Nichts auf dem Umschlag deutet darauf hin, dass die Erzählung nur etwas mehr als die Hälfte des schmalen Büchleins füllt. Die andere Hälfte besteht aus einem Interview mit dem Autor, das in gekürzter Form im September des vergangenen Jahres im Magazin der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Der Regen währt nur 50 Seiten mit viel Durchschuss.
Bauernfängerei? Vielleicht ein zu starkes Wort. Aber Mogelpackung allemal.
|
Thomas Rothschild - 12. August 2023
2780
|
 Bekenntnisse eines Misanthropen
Bekenntnisse eines Misanthropen
|
Der geniale Ausspruch wird meist Johann Nepomuk Nestroy zugeschrieben: „Der Mensch is' gut, aber die Leut' san a G'sindel!“ In der Tat gibt es wenig Gründe, die Leut' ins Herz zu schließen. Die Propagierung der Menschenliebe und die Diffamierung der Misanthropie haben ausschließlich pragmatische Gründe. Sie sollen das Zusammenleben, auf Kosten der Wahrheit, vereinfachen. Einmal mehr wird ein Ideal als Realität ausgegeben. Das Schaf soll den Wolf lieben, der Ausgebeutete den Ausbeuter und der Ruhebedürftige den Störenfried.
Ich bekenne mich zur Misanthropie, die nicht in meinen Genen liegt, auch nicht an meinem Elternhaus, sondern auf Erfahrungen beruht. Zum Beispiel auf Urlaubsreisen. Ich mag keine Touristen, die gewohnheitsmäßig am Essen irgendetwas auszusetzen haben, als würden sie daheim zum Frühstück Kaviar und Austern verschlingen. Mir sind Egozentriker zuwider, die sich in Deutschland über jeden Syrer oder Afghanen erregen, der gerade ein Jahr im Land lebt und die Sprache nicht beherrscht, im Ausland aber jeden auf Deutsch ansprechen, als müsse man das auf der ganzen Welt verstehen. Ich verabscheue die Männer, Frauen und Kinder, die im Pool stundenlang Bälle umherwerfen, brüllen und spritzen, wo andere in Ruhe schwimmen wollen.
Es ist mir egal, ob sie in Badehosen und -latschen im Restaurant sitzen, weil das mein Wohlbefinden nicht stört. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn sie so tun, als wären sie allein auf der Welt und dabei von der Annahme ausgehen, dass alle ihren Nachwuchs so süß finden müssen wie sie selbst. W.C. Fields meinte einmal: "Wer Hunde und kleine Kinder hasst, kann kein ganz schlechter Mensch sein." Das wurde ihm als zynisch angelastet und ist es wohl auch. Dabei war das vor fast 100 Jahren. Heute, da Kindern nichts mehr verboten und ihr Recht auf Selbstverwirklichung auf Kosten der restlichen Menschen nicht eingeschränkt werden darf, hat der Satz an Plausibilität gewonnen. Zumindest für Misanthropen, wie ich einer bin. Dabei erweisen die scheinbar liberalen Eltern ihren Kindern einen Bärendienst. Wo sollen diese lernen, mit einer widrigen Situation umzugehen, das, was Psychologen „Resilienz“ nennen, wenn ihnen jeder Wunsch augenblicklich erfüllt wird und jeder Verzicht als unzumutbar gilt?
Zum Glück gibt es auf kultura-extra.de keine Kommentarfunktion. Den Shitstorm, den ich mit dieser Kolumne auslösen würde, kann ich mir denken. So sind sie halt, die Leut'.
|
Thomas Rothschild - 4. August 2023
2779
|
 Unter sich keinen Sklaven
Unter sich keinen Sklaven
|
Neulich traf ich bei einer Totenfeier eine alte Bekannte, die in einer kommunistischen Familie aufgewachsen und mit den kulturellen Ritualen des Milieus gut vertraut ist. Sie hat Geschichte studiert und rechtzeitig begriffen, dass es für die Karriere förderlich ist, wenn man sich der Sozialdemokratie andient. Die Rechnung ist geradezu fulminant aufgegangen.
Unser verstorbener Freund hatte sich für seine Totenfeier ein Kampflied von Bertolt Brecht gewünscht, das über Lautsprecher ertönte. Meine Bekannte wandte sich zu mir und sagte:„Das macht mich immer noch sentimental, obwohl ich längst nichts mehr damit zu tun habe.“ Gerne hätte ich sie gefragt, was an Brechts Text falsch sei, da war sie schon in die Welt des bürgerlichen Wohlstands entschwunden.
Im Einheitsfrontlied heißt es:
"Und weil der Mensch ein Mensch ist
Drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern
Er will unter sich keinen Sklaven sehen
Und über sich keinen Herrn"
Das war schon zu Brechts Zeiten mehr Wunsch als Gegebenheit. Die Sache mit dem Herrn hat sich in den 89 Jahren seit der Entstehung des Liedes ein wenig geändert, zumal wenn der Herr ein Herr, also männlichen Geschlechts ist. Aber wie verhält es sich mit den Sklaven, den der Mensch nicht unter sich sehen will? Hat er, wenn er zufällig in Deutschland oder Österreich geboren wurde, Hemmungen, polnische Frauen schlecht bezahlt als „Reinigungskräfte“ oder als Pflegerinnen für sich arbeiten zu lassen, und was wäre das anderes, als die moderne Form der Sklaverei? Kommen ihm Bedenken, wenn er gegen „Wirtschaftsflüchtlinge“ wettert, und jene, die es doch zu uns schaffen, zu einem Lohn, den keine Gewerkschaft und kein „Eingeborener“ akzeptieren würde, Schwarzarbeit verrichten lässt? Welche, außer einer Sklavenhalterlogik, rechtfertigt die Zumutung, dass nur jene von einem mehr oder weniger fortschrittlichen Sozialsystem profitieren sollen, die durch Zufall innerhalb der Grenzen der EU zur Welt kamen? Das hegemoniale Denken der Nationalstaaten setzt sich bei den eifrigen Befürwortern der Europäischen Union fort. Die Menschen aus dem Rest der Welt sind potenzielle Sklaven, nicht anders als die einst in die USA importierten Afrikaner, die keinen Anspruch auf Krankenversorgung, Bildung oder Schutz vor Ausbeutung haben sollen.
Damit will meine alte Bekannte nichts mehr zu tun haben. Jedenfalls nicht in den Worten von Bertolt Brecht. Sie war schon klüger, als sie einst seine Lieder sang.
|
Thomas Rothschild - 31. Juli 2023
2778
|
 Nicht was, sondern wer
Nicht was, sondern wer
|
„Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist!“ Der berühmte Vers aus der Fledermaus von Johann Strauß und seinen Librettisten Karl Haffner und Richard Genée dürfte den meisten Linken verdächtig sein.
Noch suspekter ist ihnen wohl die Weisheit des populären Wienerlieds: „Wann der Herrgott net will, nutzt es gar nix, schrei net um, bleib schön stumm, sag, es war nix.“ Selbst wenn der „Herrgott“ als Metapher verstanden wird, in der Bedeutung von „Schicksal“ oder „die Umstände“: zu den Überzeugungen der Linken gehört es, dass alles veränderbar und nichts so schmählich sei, wie sich mit dem Schlechten abzufinden und dazu zu schweigen. Der Fatalismus hat für sie einen üblen Geruch.
Doch dann erinnert man sich an Bertolt Brechts Mahnung aus Me-ti. Buch der Wendungen:
„Gehen nach Orten, die durch Gehen nicht erreicht werden können, muss man sich abgewöhnen. Reden über Angelegenheiten, die durch Reden nicht entschieden werden können, muss man sich abgewöhnen. Denken über Probleme, die durch Denken nicht gelöst werden können, muss man sich abgewöhnen, sagte Me-ti.“
Diese Einsicht hat Brecht mehrfach variiert, zum Beispiel in der Gedichtüberschrift: „Keinen Gedanken verschwende auf das Unabänderbare!“ Und auf einmal gewinnt die Erwägung, die sich nur in der Formulierung von jener der Fledermaus oder des Wienerlieds unterscheidet, Plausibilität und die Zustimmung der Linken.
Jeder Glaube hat seine Bibel, und seine Propheten wachen darüber, dass sie nicht beschädigt wird. Sie haben das Denken verabschiedet – nicht, weil es keine Probleme lösen kann, sondern weil sie keine Probleme lösen, weil sie nichts verändern wollen. Sie fragen nicht danach, ob, was jemand sagt, falsch oder richtig ist, sondern wer es sagt. Sie vertrauen nur den Frauen und Männern mit Stallgeruch und verdächtigen unüberprüft die Aussagen der „Gegner“.
Das vereinfacht zwar die Orientierung in einer unübersichtlichen Welt. Der Wahrheit dient es nicht. Aber was kümmert das die Frommen der zweiten Generation, die von den ursprünglichen Erkenntnissen immer nur ein paar Glaubenssätze verstanden haben und nachplappern. Wer nicht begreift, was gesagt wird, orientiert sich, auch in Zeiten der Diversität, am eindeutig Feststellbaren: wer es gesagt hat. Basta.
|
Thomas Rothschild - 23. Juli 2023
2773
|
 Nachruf als Realsatire
Nachruf als Realsatire
|
„New York. Alle Bandmitglieder und die komplette Entourage waren längst eingetroffen, taten sich an der Bar gütlich oder labten sich an einem wahrlich umfangreichen kalt-warmen Büfett. Als Allerletzter betrat an jenem Abend im März 2003 der Star des Abends den VIP-Raum der Frankfurter Festhalle, so unprätentiös, als wäre er einer wie jeder andere. Harry Belafonte spazierte mit seinen federnd-leichten Schritten zum Büfett, unter dem sich angesichts der aufgetürmten Delikatessen fast die Tische bogen – und kehrte mit nichts als einem kleinen Schälchen Suppe und einem trockenen Brötchen zurück.“
Jan Ulrich Welke, journalistisch mit stilistisch begnadeten Hymnen über die Rockmusik der siebziger Jahre ausgelasteter stellvertretender Leiter der Kulturredaktion der Stuttgarter Zeitung in seinem Präludium zu einem Nachruf auf Harry Belafonte, der uns vor allem eins mitteilt: er, Welke, war dabei bei dem „wahrlich umfangreichen kalt-warmen Büfett“, unter dem sich die Tische „angesichts“ (!) der Delikatessen nicht ganz, sondern nur fast bogen, tat sich gütlich und labte sich. Schmatz! Zu Welkes Verteidigung muss man sagen: er balanciert auf dem Niveau, das die Stuttgarter Zeitung seit ihrer Fusion mit den Stuttgarter Nachrichten eingenommen hat. Dort bewegt er sich im Mittelfeld.
Um im Jargon der gelifteten StZN zu verharren:
„Was taugen die Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten? Hier verraten wir Dir die Namen der 10 peinlichsten Mitarbeiter.“
1. Gunther Reinhardt
2. Uwe Bogen
3. Matthias Ring
4. Jan Georg Plavec
5. Jan Ulrich Welke
6. Nikolai B. Forstbauer
7. Andrea Kachelrieß
8. Daniela Eberhardt
9. Tanja Simoncev
10. Anja Wasserbäch
|
Thomas Rothschild – 26. April 2023
2765
|
 Wie Luise F. Pusch die Frauen unsichtbar gemacht hat
Wie Luise F. Pusch die Frauen unsichtbar gemacht hat
|
Während des Prager Frühlings erzählte man sich ein Gleichnis, das die Reformvorschläge des Ökonomen Ota Šik charakterisieren sollte: Man habe festgestellt, dass es in England weniger Verkehrsunfälle gebe als auf dem Kontinent. Um zu überprüfen, ob das am Linksverkehr liege, sollte die Hälfte der Taxis versuchsweise auf der linken Straßenseite fahren, die andere Hälfte aber rechts.
Das Gleichnis und seine leicht zu erschließende Lehre lassen sich ohne Verlust auf die gegenwärtige Debatte über das Gendern übertragen. Seit nunmehr einem halben Jahrhundert erklären uns die Linguistin Luise F. Pusch und ihre Doppelgängerin Senta Trömel-Plötz, deren wissenschaftliche Überzeugungskraft von ihren Anhängerinnen und Anhängern ebenso wenig in Zweifel gezogen wird wie die Existenz Gottes von gläubigen Katholiken, von vielen Fachkolleginnen und Fachkollegen hingegen vermisst wird, dass der bis zur Erfindung der „feministischen Linguistik“ übliche Gebrauch der deutschen Sprache Frauen „unsichtbar“ mache. Das sogenannte „generische Maskulinum“, bei dem das grammatische Geschlecht als natürliches Geschlecht (miss)verstanden werden könne, schließe den weiblichen – mittlerweile auch den weder männlichen noch weiblichen, also den „queeren“, im deutschen Wortschatz nicht einmal vorgesehenen – Teil der Menschen aus.
Seither hat man zahlreiche konkurrierende Schreib- und Sprechweisen ersonnen, um die Möglichkeiten des natürlichen Geschlechts zu markieren, ohne jeweils Doppel- oder Mehrfachnennungen aufführen zu müssen. Nun hat eine jüngere Untersuchung ergeben, dass 35 Prozent der Befragten die Benutzung von Symbolen wie Sternchen oder Doppelpunkt gut finden, 59 Prozent dagegen nicht. Auch die Sprechpause vor der weiblichen Endung eines Wortes lehnt die überwiegende Mehrheit ab. Gut oder sehr gut finden das 27 Prozent, weniger gut oder gar nicht gut 69 Prozent. Ein demokratischer, wenngleich schwer begründbarer Befund.
Was tun? Den Vorschlägen und den Argumenten von Pusch, Trömel-Plötz und Tausenden von Followern folgen, die nicht unbedingt zu den Sprachvirtuosen zählen und korrekt gegenderte, aber grammatisch wie stilistisch haarsträubende Hausarbeiten verfassen, oder sich einer Mehrheit gefügig machen, die ja nicht recht haben muss. Vergessen wir nicht: als die feministische Linguistik noch nicht ihr Haupt erhoben hatte, gab es Landstriche und Subkulturen, in denen eine Mehrheit Stalin für den bedeutendsten Linguisten des 20. Jahrhunderts und seine Schrift Der Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft für einen genialen Wurf hielt.
Wir leben also in einer Welt, in der sich viele Individuen, Zeitschriften, Verlage, Pädagogen entschlossen haben, je nach Gusto Doppelpunkte, Sternchen, Schrägstriche (neudeutsch: Slashes) oder Doppelnennungen zu verwenden. Frauen und, wenn man Glück hat, Transgender-Personen finden ihre sprachliche Repräsentation. Das könnte gut gehen, wenn nicht nur 35 Prozent, sondern alle Benutzer der deutschen Sprache das Gendern nicht nur gut fänden, sondern es auch praktizierten. Tun sie aber nicht. Und so fährt ein Teil der Taxis auf der linken und ein Teil auf der rechten Straßenseite.
Was bedeutet das? Wenn das grammatische mit dem natürlichen Geschlecht von vielen, nicht aber von allen gleichgesetzt wird, verliert die Sprache ihre relative Eindeutigkeit. Bis zu Pusch und Trömel-Plötz wusste jede und jeder, dass von Frauen und Männern die Rede war, wenn man von Zuschauern, Fahrgästen oder Ärzten sprach, wie jede und jeder wusste, dass auch Frauen nicht über die Kreuzung gehen sollten, wenn an der Ampel ein rotes Männchen aufleuchtete. Wenn nun eine Hälfte der Sprecher (und Sprecherinnen!) mit Zuschauern etc. nur männliche Exemplare der Spezies meint, die andere Hälfte aber, die Sternchen oder Doppelpunkte ablehnt und das generische Maskulinum verwendet, darauf vertraut, dass ihre Kommunikationspartner dieses generische Maskulinum verstehen, dann machen die koexistierenden Normen genau das, was Pusch u.a. verhindern wollten: die Frauen unsichtbar. Für die Gläubigen der Puschschen Religion ist ja, wer nicht durch Gendern markiert ist, nicht vorhanden. Die Sprache büßt für sie ihre Funktion ein wie das Gebet im Gottesdienst ohne das Amen. Die Taxis krachen aufeinander, weil die beiden Systeme nicht vereinbar sind.
Wahrscheinlich müssen wir da durch. Bis Pusch und Trömel-Plötz in der verdienten Vergessenheit versunken sind wie der Sprachwissenschaftler Stalin. Und die klimaneutrale oder vegane Sprache übernimmt. Man sollte sich bei den Diskussionen über eine Rechtschreibreform beizeiten darauf einstellen.
|
Thomas Rothschild - 22. Februar 2023
2760
|
 Netanjahu und die Taliban
Netanjahu und die Taliban
|
Der österreichische „Standard“, über jeglichen Verdacht des Antisemitismus erhaben, meldet am 26.12.2022:
„Israels neue Regierung will Diskriminierung legalisieren. Darauf haben sich Benjamin Netanjahus Likud-Partei und ihre rechtsextremen und ultraorthodoxen künftigen Koalitionspartner geeinigt. Private Dienstleister sollen beispielsweise homosexuelle, weibliche oder nichtjüdische Kunden ausschließen können, wenn ihr religiöses Empfinden das verlangt.
Was nach einer abstrakten Gesetzesänderung klingt, wurde durch zwei Radiointerviews von Abgeordneten der rechtsextremen künftigen Regierungspartei Religiöse Zionisten am Sonntag plötzlich sehr konkret: 'Man kann einen Arzt nicht dazu verpflichten, einen Patienten zu behandeln', erklärte Orit Strock, die künftige israelische Ministerin für nationale Missionen, in einem Live-Interview mit dem israelischen Radiosender Kan II.
Wenn sich beispielsweise eine unverheiratete Frau an einen Arzt wende, weil sie schwanger werden möchte, dann wäre das so ein Fall. Strocks Parteikollege Simcha Rothman erklärte, dass es für Hotelketten wohl auch legitim sei, schwule oder lesbische Paare auszuschließen – 'aus Gründen des religiösen Glaubens' müsse das erlaubt sein.“
Unglaublich, was sich die Taliban und die islamistischen Iraner da in und für Israel vorgenommen haben. Zum Glück gibt es die Proteste der zivilisierten Welt, die ohne Wenn und Aber jene an den Pranger stellen werden, die das ohne Widerspruch zulassen oder gar Entschuldigungen dafür finden. Alles andere wäre Doppelmoral.
Und wer nun sagt, diese Glosse spiele den Antisemiten in die Hände, dem sei geantwortet: Es sind die im Standard gemeldeten Zustände und jene, die sie verteidigen, die den Antisemitismus mit offenen Augen fördern.
|
Thomas Rothschild - 27. Dezember 2022
2757
|
 Ab in den Müll
Ab in den Müll
|
Dieser Tage berichteten die Medien von den Ergebnissen einer Studie, wonach Altersdiskriminierung, also die gesellschaftliche und berufliche Benachteiligung wegen des Alters, in Deutschland zum weitgehend widerspruchslos hingenommenen Alltag gehört. Sieht man sie nicht, oder will man sie nicht sehen, weil eine angemessene Reaktion, wie etwa bei der Diskriminierung von Frauen, Nachteile einbrächte? Ein #MeToo der Alten erntete nicht Empathie, sondern Hohn.
Dass die Berufskollegen schweigen, wenn ältere Arbeitnehmer entsorgt werden, ist ebenso offensichtlich wie erklärbar. Sie profitieren von der Entfernung der Konkurrenz, und sie sind dabei nicht zimperlich. Sie verhöhnen hinter deren Rücken auch jene, die sie einst gefördert haben, denen sie Ratschläge und Tipps zu verdanken haben. Solidarität kommt nur noch in unverbindlichen Texten, nicht am Arbeitsplatz vor. Und keine Schweinerei ist zu groß, als dass man sie nicht mitmachte, wenn sie Vorteile verheißt.
So ist das nun einmal. Es entspricht den Spielregeln unserer Konkurrenz- und Ellbogengesellschaft. Und wenn man zynisch genug ist, kann man sich damit trösten, dass es bald auch jene treffen wird, die heute zu den Profiteuren gehören. Alt wird jede oder jeder, so er nicht das Glück hat, vorher zu sterben. Enttäuschender jedoch als der Opportunismus und die Gemeinheit der Kollegen ist die Untätigkeit der Konsumenten, der Leser*innen und Hörer*innen. Nach und nach verschwinden Autoren und Autorinnen aus den Zeitungsspalten und den Sendungen, die man über Jahre hinweg gerne, oft fast süchtig gelesen und gehört hat. Sind sie gestorben? Wurden sie von der Demenz überfallen? Hatten sie von sich aus nichts mehr zu sagen, keine Lust sich zu äußern? Die Leser*innen und Hörer*innen interessiert das nicht. Sie fragen nicht danach. Sie schreiben keine Proteste an die Redaktion. Die Alten dürfen ungehindert ausgeschlossen werden wie vor kurzem noch die Frauen, die Farbigen, die Homosexuellen, die Behinderten. Kein wirksames Gesetz, keine Kampagne, keine Lobby schützt sie. Ab in den Mülleimer wie die Figuren von Samuel Beckett.
Und wer nun meint, ich würde übertreiben, denke einen Moment darüber nach, wessen Artikel in der Zeitung, wessen Kommentare im Rundfunk oder im Fernsehen er oder sie vor zehn Jahren regelmäßig genossen hat und was er oder sie über deren Verbleib weiß. In englischsprachigen Medien gibt es die Abteilung „Where are they now?“ Wo sind sie jetzt? Im Altersheim? Im Grab? Oder doch bloß ausgesondert wegen ihres Alters? Wen juckt es?
|
Thomas Rothschild - 21. Dezember 2022
2756
|
 Der blinde Fleck
Der blinde Fleck
|
Im SWR gibt es eine Sendung namens Nachtcafé. 1987, damals noch beim inzwischen mit dem SWF fusionierten, also de facto vernichteten SDR „erfunden“, wurde sie 27 Jahre lang von Wieland Backes moderiert. Seine Nachfolge hat Michael Steinbrecher angetreten. Bei Nachtcafé handelt es sich um eine konventionelle Talkshow, die sich in ihrer wohltuend altmodischen Seriosität vom üblichen täglichen Klamauk und Unterhaltungsschwachsinn abhebt.
Am 11. November ging es um das Thema Dialekt - angesagt oder peinlich? Die Erfahrungsberichte und Diskussionen der Teilnehmer, unter denen keine und keiner Dialekt als peinlich empfand – einer, Professor in Tübingen, lebt davon –, waren zwar wenig kontrovers, aber nicht uninteressant. Sie litten nur unter einem Manko: Das Wort „Soziolekt“ kam nicht vor.
Das Wienerische gibt es in der Küche, aber nicht in der Sprache. Ich wähle das Beispiel, bei dem ich mich am besten auskenne. Aber es ist nicht einzigartig. So unterscheidet sich etwa das so genannte Honoratiorenschwäbisch stärker vom Schwäbisch eines Daimler-Arbeiters als das Ulmer Schwäbisch vom Pforzheimer Schwäbisch, dessen sich in der Sendung Dieter Kosslick rühmte.
Ottakringerisch hat mit Burgtheaterdeutsch ebenso wenig zu tun wie das „Wienerisch“ von Helmut Qualtingers Herrn Karl mit dem „Wienerisch“ eines Karl Schwarzenberg, nämlich fast nichts. Diese Unterschiede aber sind von Belang für fast alle Aspekte, die im Nachtcafé angesprochen wurden: ob man wegen seines Dialekts benachteiligt werde, ob ein Dialekt als „schön“ empfunden werde, ob es sinnvoll sei, in der Schule im Sinne der kompensatorischen Erziehung auf Hochdeutsch zu bestehen. Es scheint nicht von der Hand zu weisen, dass jemand, der spricht wie Paula Wessely, im Berufsleben oder gar bei der Suche nach einem Bankkredit weniger Hindernissen begegnet als ein Native Speaker mit der Sprache einer Supermarktverkäuferin aus Floridsdorf. Wahrscheinlich wird ihm auch eher eine Parkstrafe erlassen.
Dass die Talkshow, inklusive des Tübinger Professors, dafür blind war, jedenfalls keinen Dialekt fand, es zu formulieren, dürfte symptomatisch sein. Geographische Unterschiede liegen den öffentlichen Debatten näher als soziale Unterschiede. Sie fordern nicht zum Handeln heraus. Das Saarland kann man ebenso wenig gegen Niedersachsen auswechseln wie die Wiener Innenstadt gegen die Leopoldstadt, die ehemalige „Mazzesinsel“, auf der anderen Seite des Donaukanals. Gegen die Bevorzugung von Menschen mit bürgerlichem oder aristokratischem Hintergrund vor Menschen mit proletarischem Hintergrund ließe sich eine Menge unternehmen. Aber wer will das schon? Selbst den politischen Repräsentanten des „Roten Wien“, oder was davon geblieben ist, steht das Burgtheater näher als der Karmelitermarkt. Man hört es an ihrer Sprache. Ist es ein Dialekt? Doch wohl eher ein Soziolekt.
Noch ist Zeit für ein Nachtcafé zum Thema: Soziolekt - angesagt oder peinlich? Wo oi wille isch, isch oi Weg.
|
Thomas Rothschild - 13. November 2022
2755
|
 Trauer zu spät
Trauer zu spät
|
Es vergeht kaum eine Woche, in der mich nicht die Todesnachricht von jemandem erreicht, den ich einmal gut gekannt habe oder der für meine Biographie eine entscheidende Rolle gespielt hat. Zwar wurde mein Vater 16 und meine Mutter 15 Jahre älter, als ich jetzt bin, aber sie haben gesünder gelebt als ich. Realistischerweise muss ich damit rechnen, dass ich jederzeit sterben kann. Ich halte es für kindisch, das zu verdrängen, und den Trost eines Lebens nach dem Tod benötige ich nicht.
Ich fürchte den Tod nicht. Jedenfalls nicht mehr als Krankheit und Hilflosigkeit. Der Tod ist nicht so sehr für jenen, den er trifft, tragisch, wie für die Lebenden, die er hinterlässt. Der Verstorbene fehlt, jedenfalls meistens. Vor allem aber: mit ihm sterben auch die Antworten auf die Fragen, die man ihm gerne noch gestellt hätte.
Heute traf die Nachricht ein, dass Paul Stein – damals, als wir uns alle im Diminutiv ansprachen: Pauli Stein – am 9. Mai gestorben ist. Er war ein Jahr älter als ich und gehörte in den frühen sechziger Jahren zu meinem engsten Freundeskreis. Er war, jedenfalls nach dem frühen Tod von Ernstl Koplenig, der Intelligenteste unter meinen Freunden. Wir haben beide damals für eine Jugendzeitschrift geschrieben, und ich habe ihn stets um seinen virtuosen Stil, seine pointierten Formulierungen beneidet. So wie er, wollte ich texten können.
Keiner konnte in Discos, die damals noch Jazzkeller hießen, so gut und elegant tanzen wie er, vorwiegend mit der ebenfalls bereits verstorbenen Toni Spira. Darum beneidete ich ihn zwar nicht so sehr, aber bewundert habe ich ihn schon.
Als ich promovierte, wurden wir einander fremd. Ich konnte ihn nie fragen, woran das lag. Vermutlich war ich für ihn mit dem Abschluss des Studiums in der bürgerlichen Welt versackt. Er selbst ging mit seiner Frau für fünf Jahre nach China, wo er eine deutschsprachige Publikation redigierte.
Als er nach Wien zurückkehrte, lebte ich bereits in Deutschland. Pauli Stein ging verschiedenen Tätigkeiten nach, unter anderem als Außenlektor für Verlage, aber sie blieben – nach meiner Meinung – immer hinter seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zurück. Ob er es selbst so empfand, ob er darunter litt, weiß ich nicht. Wir hatten kaum noch Kontakt mit einander. Einmal nahm er mir eine veröffentlichte Kritik an Robert Schindel übel, mit dem er eng befreundet war. Zu meinem fünfzigsten Geburtstag, zu den ich ihn eingeladen hatte, kam er nicht.
Im vergangenen Oktober wohnte ich ein paar Tage in einem Hotel ganz in der Nähe des Hauses, in dem er als Kind gelebt hatte, sowie seines Stammcafés, des Cafés Goldegg. Ich fand heraus, dass er nach wie vor dort wohnte, und überlegte, ob ich bei ihm anläuten solle. Dann aber hatte ich Angst, dass eine Begegnung unerfreulich sein und meine Erinnerungen torpedieren könnte, und verzichtete darauf. Im Geheimen hoffte ich, ihm auf der Straße oder im Goldegg über den Weg zu laufen.
Jetzt ist es zu spät. Hier stehe ich mit all den ungefragten Fragen, die ich ihm – und meinen Eltern, und den vielen verstorbenen Freunden und Bekannten – gerne gestellt hätte. Der Tod ist doch schlimm. Der Tod der anderen.
|
Thomas Rothschild - 18. Mai 2022
2747
|
 Ja das Schreiben und das Lesen
Ja das Schreiben und das Lesen
|
Was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, hängt weitgehend von der Größe und der Stärke der Lobbys ab, die an diesen Diskussionen interessiert sind, weil sie davon zu gewinnen haben. Seit Jahren hat der Feminismus die Diskurshoheit an sich gerissen, und zwar nicht die Fraktion des Feminismus, die einst Häuser für geschlagene Frauen eröffnet, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, die Bezahlung von Hausarbeit und Kindererziehung gefordert hat, sondern jene Fraktion, die besonders artikuliert ist, die Mittel und den Zugang zu den Medien besitzt, um sich Gehör zu verschaffen, und vertraut ist mit den Methoden der männlichen Gegenspieler, deren Privilegien sie nicht etwa abschaffen, sondern sich aneignen möchte, die also keineswegs mehr (Verteilungs)Gerechtigkeit anstrebt, sondern die Partizipation an der herrschenden Ungerechtigkeit: die Fraktion des Großbürgertums. Mit unschöner Regelmäßigkeit wird nachgezählt, wie hoch der Prozentsatz von Frauen in Aufsichtsräten, Konzernvorständen, Präsidien ist. Die materielle und soziale Diskriminierung von Reinigungskräften, Fließbandarbeiterinnen, Supermarktkassiererinnen, Sekretärinnen interessiert kaum mehr. Sie eignet sich nicht für Schlagzeilen.
Zu den Topoi von Zeitungsartikeln, aber auch von Magisterarbeiten gehören seit langem Klagen über die Unterrepräsentation von Frauen in den Künsten, sowohl unter den Schöpfern, wie auch in deren Produkten. Es gibt jede Menge Statistiken über das Zahlenverhältnis zwischen männlichen und weiblichen Protagonist*innen in der Literatur. Sie fallen, wenig überraschend, zu Ungunsten der Frauen aus. Wann aber wurde zuletzt nachgezählt, wie oft Menschen – Frauen wie Männer – im Mittelpunkt von Büchern stehen, die in Armut aufgewachsen sind, die schon als Kinder schwere körperliche Arbeit leisten mussten, die Bildung überhaupt nicht oder nur unter ungünstigsten Bedingungen erlangen konnten? Die Armen kommen in der Literatur, wenn überhaupt, fast nur als Nebenfiguren vor. Wo sind die bäuerlichen und proletarischen Pendants zu den Fausts und den Wallensteins, den Buddenbrooks und den Salinas, den Briests, den Bovarys, den Kareninas? Oliver Twist mag einem einfallen. Und darüber hinaus? Es gibt sie, die Armen und Unterprivilegierten als literarische Helden, aber die Liste ist kurz.
In dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz vom Ende des 18. Jahrhunderts kann man nachlesen (aber wer liest ihn noch?), was es für den Titelhelden bedeutet, Lesen und Schreiben zu lernen. Nicht weniger drastisch ist die Darstellung in Franz Michael Felders Autobiographie Aus meinem Leben. Mit ihr lässt sich das eben wieder gedruckte Buch Die Schwabengängerin von Regina Lampert vergleichen. Wer allerdings meint, die kaum vorstellbaren Leiden einer Kindheit in Armut gehörten der ferneren Vergangenheit an, lege sich Franz Innerhofers Schöne Tage oder Gernot Wolfgrubers Herrenjahre aus den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts aufs Nachtkästchen. In die selbe Kategorie fällt das 2009 erschienene Gasthauskind von Ingried Wohllaib. Und gerade erst vor zwei Jahren hat Christian Baron Ein Mann seiner Klasse veröffentlicht. Inzwischen hat diese Lebensbeschreibung sogar die Theaterbühne erreicht. Interesse ist offenbar vorhanden. Das kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Armen kaum ein Thema sind für Empörung, Manifeste und Quoten. Sie haben eben keine Lobby. Und wer, außer ihnen selbst, hätte Interesse daran, sie so wichtig zu nehmen wie die Zahl der Ministerinnen in einer Regierung. Die geführt wird von einer Partei, die sich einst als Vertreterin der Arbeiterklasse verstand. Lang, lang ist’s her.
|
Thomas Rothschild - 16. April 2022
2746
|
 Deniz Yücel vs. 5 Präsidenten
Deniz Yücel vs. 5 Präsidenten
|
Regula Venske, Vorgängerin von Deniz Yücel als Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland und Mitunterzeichnerin der Aufforderung an Yücel, zurückzutreten, bei ihrer Antrittsrede als PEN-Präsidentin: „Das Wort ist die Waffe, die die Herrschenden in autoritären Regimen weltweit am meisten fürchten." Na dann… Hoffentlich ist Putin davon beeindruckt. (Es wäre ja komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Leider aber ist es typisch für den PEN, ob deutsch oder international: große Worte und keine Wirkung. Außer vielleicht bei befreundeten Kolleginnen in der F.A.Z.)
|
Thomas Rothschild - 27. März 2022 (2)
2745
|
 Deniz Yücel, Edmund Burke und die Gleise nach Auschwitz
Deniz Yücel, Edmund Burke und die Gleise nach Auschwitz
|
Deniz Yücel habe seine Befugnisse überschritten, als er in seiner Funktion als Präsident des PEN-Zentrums Deutschland bei einer Veranstaltung von Lit.Cologne seine eigene Meinung zu einer möglichen Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine bekannt gab, befinden fünf Ex-Präsidenten der Schriftstellervereinigung und fordern Yücels Rücktritt. John Ralston Saul, der Präsident des Internationalen PEN in den Jahren 2009-2015, den die unmittelbare Vorgängerin Yücels Regula Venske verehrte und gegen jede Kritik bedingungslos in Schutz nahm, wofür er sie in das Präsidium von PEN International holte, hatte einen Lieblingstext, aus dem er gerne zitierte. Er stammt von dem Politiker und Philosophen Edmund Burke, ist eine Rede an die Wähler von Bristol aus dem Jahr 1774, und sagt, höchst zeitgemäß, im Wortlaut:
„Gewiss, meine Herren, es sollte das Glück und der Ruhm eines Volksvertreters sein, in engster Verbindung, völliger Übereinstimmung und rückhaltlosem Gedankenaustausch mit seinen Wählern zu leben. Ihre Wünsche sollten für ihn großes Gewicht besitzen, ihre Meinung seine hohe Achtung, ihre Interessen seine unablässige Aufmerksamkeit. Es ist seine Pflicht, seine Ruhe, seine Freuden und seine Befriedigungen den ihren zu opfern; und vor allem in jedem Falle ihre Interessen den seinen vorzuziehen. Doch seine unvoreingenommene Meinung, sein ausgereiftes Urteil, sein erleuchtetes Gewissen sollte er weder euch, noch irgendeinem Menschen oder irgendeiner Gruppe von Menschen aufopfern; denn er leitet sie nicht von eurer Gunst her, noch aus dem Recht oder der Verfassung. Sie sind ein von der Vorsehung anvertrautes Gut, für dessen Missbrauch er voll verantwortlich ist. Euer Abgeordneter schuldet euch nicht nur seinen ganzen Fleiß, sondern auch einen eigenen Standpunkt; und er verrät euch, anstatt euch zu dienen, wenn er ihn zugunsten eurer Meinung aufopfert. [...]
Eine Meinung zu äußern, ist das Recht aller Menschen; diejenige der Wähler ist eine gewichtige und achtenswerte Meinung, die zu hören ein Volksvertreter sich stets freuen sollte und die er immer auf das ernsthafteste erwägen müsste. Doch verbindliche Anweisungen, erteilte Aufträge, die das Parlamentsmitglied blindlings und ausdrücklich befolgen muss, für die es seine Stimme abgeben und für die es eintreten soll, obgleich diese Instruktionen im Gegensatz zur klarsten Überzeugung seines Urteils und Gewissens stehen mögen, sind Dinge, die den Gesetzen unseres Landes völlig unbekannt sind und die aus einem fundamentalen Missverständnis der gesamten Ordnung und des Inhalts unserer Verfassung entspringen. Das Parlament ist kein Kongress von Botschaftern im Dienste verschiedener und feindlicher Interessen, die jeder als Vertreter und Befürworter gegen andere Vertreter und Befürworter verfechten müsste, sondern das Parlament ist die beratende Versammlung einer Nation, mit einem Interesse, dem des Ganzen, wo nicht lokale Zwecke, nicht lokale Vorurteile bestimmend sein sollten, sondern das allgemeine Wohl, das aus der allgemeinen Vernunft des Ganzen hervorgeht. Wohl wählt ihr allein einen Abgeordneten, aber wenn ihr ihn gewählt habt, dann ist er nicht mehr Vertreter von Bristol, sondern ein Mitglied des Parlaments. Falls der lokale Wähler ein Interesse verfolgen oder sich eine voreilige Meinung gebildet haben sollte, die ganz offensichtlich im Widerspruch zum wahren Wohl der restlichen Gemeinschaft stehen, dann sollte der Abgeordnete dieses Wahlkreises, so gut wie jeder andere, davon Abstand nehmen, diese Sonderinteressen durchzusetzen. [...] Ein gutes Mitglied des Parlaments zu sein, ist keine leichte Aufgabe; besonders in dieser Zeit, in der eine starke Neigung besteht, sich in einen gefährlichen Grad von sklavischer Willfährigkeit oder zügelloser Popularität zu stürzen. Umsicht mit Energie zu vereinen, ist absolut notwendig, aber äußerst schwierig. Wir sind jetzt Bürger einer reichen Handelsstadt, diese Stadt ist jedoch ein Teil einer reichen Handelsnation, deren Interessen verschieden, vielfältig und kompliziert sind. Wir sind Angehörige einer großen Nation, die selbst wiederum nur Teil eines großen Weltreichs ist, das sich [...] bis zu den entferntesten Grenzen in Ost und West erstreckt. Alle diese weit verbreiteten Interessen müssen bedacht werden, müssen verglichen werden, müssen, wenn möglich, in Einklang gebracht werden.“
(Edmund Burke: Speeches on the American War, Boston 1898. Übersetzung nach Otto Heinrich von der Gablentz: Die politischen Theorien seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Politische Theorien Teil III. Westdeutscher Verlag. 3. Auflage. Köln und Opladen 1967, S. 82 f.)
Zur Sache selbst, deretwegen Yücel von den fünf fixen Präsident*innen der friedlichen Vergangenheit abgemahnt wird, die Erwägung nämlich, dass man Putin und seine Kriegsherren, notfalls mit Hilfe der NATO, in Schach halten müsse: auch ich bin zunächst erschrocken. Aber dann fiel mir ein, dass ich meine Großeltern nach der Rückkehr mit meinen Eltern aus dem Exil vielleicht kennen gelernt hätte, wenn die Alliierten die Bahnlinien nach Auschwitz bombardiert hätten. Dabei weiß ich, dass auch deren Armeen nicht aus lupenreinen Demokraten bestanden, dass sie der Aufrechterhaltung des Kolonialismus dienten und dass die Sowjetunion bereit war, einen Nichtangriffspakt mit dem Deutschen Reich zu schließen, wenn sich dieses Polen mit ihr teilen würde. Das hat dann nicht ganz so geklappt. Aber gekämpft haben die Alliierten nicht, um die Demokratie in Deutschland oder gar die verfolgten Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen zu retten, sondern um ihre eigenen imperialen Interessen zu verteidigen, nachdem es mit dem Münchner Abkommen schief gelaufen war. Dafür müssen wir ihnen dankbar sein, aber wir müssen nicht der Propaganda auf den Leim gehen und es idealisieren. Man muss auch kein Freund der NATO sein, um ihre Unterstützung ins Kalkül zu ziehen, wenn man damit Menschenleben rettet. Dass die Gleise nach Auschwitz nicht bombardiert wurden, hat man, als es zu spät war, als Fehler betrachtet. Hätten die fünf PEN-Präsidenten solch ein Bombardement verurteilt? Oder wollen sie jetzt warten, bis es wieder zu spät sein wird?
Der Pazifismus ist eine schöne Sache. Für jene aber, die Krieg und Verfolgung erleiden, kann er tödlich sein. Sich das einzugestehen ist eine Herausforderung.
|
Thomas Rothschild - 22. März 2022
2744
|
 Eleganz
Eleganz
|
Ich schätze die Schweizer Schriftstellerin Ilma Rakusa seit vielen Jahren, wegen ihrer Übersetzungen, wegen ihres literarischen Geschmacks, wegen ihrer Essays. Jetzt hat sie innerhalb einer Reihe des Grazer Droschl Verlags ein schmales Büchlein über die Eleganz geschrieben. Zur Damenmode äußert sie sich so: „Das ‚kleine Schwarze‘, das – gut geschnitten, gut getragen – immer für Eleganz taugt, vor allem wenn Schuhe, Handschuhe und Tasche das Ihre beitragen.“ Ich muss bekennen: ich bin perplex. Auf mich wirkt dieses scheinbare Understatement nur affig. Mir ist bewusst: das Thema hat Konjunktur, es fügt sich bruchlos in die Rückkehr des Konservatismus und den Dégout gegen alles Plebejische. Es passt in eine Umgebung, in der sich der einst stolze Begriff des Proletariers zum herablassenden Proll gewandelt hat.
Wo von Eleganz gefaselt wird, ist an vorderster Stelle, wie bei Ilma Rakusa, von Kleidung die Rede. Der Inbegriff der Eleganz bei Männern sind Frack und Smoking. Ich habe offen gestanden nie begriffen, wieso ausgerechnet die Berufskleidung von Oberkellnern oder allenfalls von heftig gestikulierenden verschwitzten Dirigenten elegant sein soll. Wenn man aber solche Bedenken äußert, wird man sofort verdächtigt, Parkas, löchrige Jeans und Birkenstock Sandalen per Dekret verordnen zu wollen. Zwar habe ich auch gegen Parkas und Jeans nichts einzuwenden. Aber es geht mir gar nicht darum, eine Eleganz durch eine andere zu ersetzen, sondern durch Funktionalität. Dass ein Frack funktional sei, wird mir niemand einreden können. Parkas und Jeans sind es zumindest in bestimmten Situationen.
Was mir aber noch verwunderlicher erscheint als die neue Wertschätzung der Eleganz in der Kleidung, ist deren Gegenläufigkeit zur Schlamperei in der Sprache. Es erfordert offenbar weniger Aufwand und Intelligenz, sich einen angeblich eleganten Anzug oder ein elegantes Kleid zu kaufen, als Sätze zu bilden, die über die Komplexität eines Smileys oder stereotyper Wendungen aus dem Jugendjargon hinaus gehen. Freilich kann man nichts damit verdienen, dass man sprachlichen Stil anpreist. Man kann ihn nicht verkaufen wie teure Klamotten.
Ich gestehe: so sehr mir Kleidungsfragen am Arsch vorbei gehen, um eine der heute beliebten Phrasen zu gebrauchen, so sehr fasziniert mich, um ein Beispiel zu nennen, die Sprache von Arthur Schnitzler (und es ist kein Versehen, wenn ich nicht Stefan Zweig oder Franz Werfel an seiner Stelle nenne). Sie entspricht dem, was ich unter Eleganz verstehe, und ist zugleich funktional: Ihre Syntax macht Gedanken transparent, ihre Wortwahl ist zugleich verständlich und überraschend, ihre Melodie eignet sich die Schönheit von Musik an, ihre Ironie ist geistreich und schlagfertig zugleich. Und zwar nicht nur bei seinen liebenswürdigen, sondern auch und gerade bei den unsympathischen Figuren. Arthur Schnitzlers Erzählungen und Dramen machen deutlich, dass Literatur aus Sprache besteht, ja dass es die Sprache ist, was ihre Botschaften erst zu Literatur macht. Man kann im Alltag über die Kränkungen einer Frau oder über Antisemitismus sprechen – und man tut es ja pausenlos –, aber es bleibt, im Vergleich mit Frau Berta Garlan oder Professor Bernhardi Geschwätz ohne ästhetischen Mehrwert. Vielleicht klingt die folgende Replik in den Ohren derer, die mit der Sprache der Social Media aufgewachsen sind, gestelzt, aber sie ist, mit Verlaub, auch schön oder eben elegant: „Wenn ich Ihnen dafür dankte, Hochwürden, dass Sie unter Ihrem Zeugeneid die Wahrheit gesprochen haben, müsste ich fürchten, Sie zu verletzen.“
Ja, mag manche oder mancher einwenden, aber Schnitzler hat vor 100 Jahren gelebt. Richtig. Wenn jedoch Smoking und Abendkleid immer noch möglich sind und als elegant gelten – warum sollte das für die Sprache, für die Literatur verboten sein? Ich plädiere ja nicht dafür, daraus eine Regel zu machen. Aber als eine Alternative zur Schnoddrigkeit bis hin zur Sprachlosigkeit sollte die Eleganz in Erinnerung bleiben. Man sollte es, wie Arthur Schnitzler sagen würde, in Betracht ziehen.
Übrigens, es mag paradox erscheinen: am ehesten wurde diese Eleganz, zwischen Schnitzler und heute, in der DDR-Literatur bewahrt, bei Uwe Johnson, bei Peter Hacks, bei Jurek Becker, bei Fritz Rudolf Fries. Einfach so, ohne Schuhe, Handschuhe und Tasche.
|
Thomas Rothschild - 10. Dezember 2021
2743
|
 Martin Pollack
Martin Pollack
|
Das PEN-Zentrum Deutschland vergibt ein Mal im Jahr den Hermann Kesten-Preis. Er zeichnet Persönlichkeiten aus, die sich im Sinne der internationalen PEN-Charta in besonderer Weise für verfolgte und inhaftierte Schriftsteller und Journalisten einsetzen. Als ich noch Mitglied des PEN-Präsidiums war, habe ich den österreichischen Journalisten und Schriftsteller Martin Pollack für diesen Preis nominiert. Mein Vorschlag hat im Präsidium keine Mehrheit gefunden. Inzwischen bin ich aus dem PEN ausgetreten, nachdem ich mit der pharisäerhaften Haltung der ehemaligen Präsidenten Josef Haslinger und Regula Venske und des heutigen Generalsekretärs Heinrich Peuckmann konfrontiert worden war. (Wer sich von der Berechtigung dieser Beschuldigung überzeugen möchte, kann über die oben [in der Grafik] stehende Mailadresse Beweisdokumente anfordern.)
Martin Pollack ist im deutschsprachigen Raum der wahrscheinlich beste Kenner der politischen Lage in Polen. 1944 in Bad Hall geboren, hat er in Wien und Warschau Slavistik und osteuropäische Geschichte studiert. Neben seiner eigenen schriftstellerischen Tätigkeit hat er sich über Jahrzehnte hinweg durch Übersetzungen, Essays, Rezensionen und kulturpolitische Initiativen konsequent und kämpferisch für Verfolgte und gegen Unrecht, vorwiegend in Osteuropa, eingesetzt und entscheidend dazu beigetragen, dass polnische und andere osteuropäische Schriftsteller im Westen bekannt wurden. Sein Engagement galt insbesondere solchen Autoren, die in ihrer Heimat nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen publizieren konnten und schikaniert wurden. Es gibt keinen würdigeren Kandidaten für einen Preis, der den Namen Hermann Kestens trägt.
Jetzt hat Martin Pollack, dessen aufklärerischer Impetus und dessen politisches Verantwortungsgefühl nach Jahren einer schweren Krankheit dem geschwächten Körper standhalten, in der österreichischen Tageszeitung Der Standard einen Essay [Zur sadistischen Radikalisierung Polens ] veröffentlicht, der es nicht verdient, im Trubel der Vielschreiberei, zumal diesseits der Grenzen, unterzugehen. Deshalb hier der Link zu einer unverzichtbaren Information. Sage keine und keiner, sie oder er habe nicht gewusst, was sich, wenige Kilometer von der deutschen Hauptstadt entfernt, abspielt.
|
Thomas Rothschild - 19. November 2021
2741
|
 Kommunikation
Kommunikation
|
In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts räsonierte der amerikanische Mathematikprofessor und geniale Liedermacher Tom Lehrer in der Abmoderation zu einem Song über Alma Mahler-Gropius-Werfel:
„Wenn wir gerade von Liebe sprechen, ein Problem, das dieser Tage immer häufiger wiederkehrt, in Büchern und Theaterstücken und Filmen, ist die Unfähigkeit von Menschen, mit Menschen, die sie lieben, zu kommunizieren: Ehemänner und Ehefrauen, die nicht kommunizieren können, Kinder, die nicht mit ihren Eltern kommunizieren können, und so weiter. Und die Figuren in diesen Büchern und Theaterstücken und so weiter, und im wirklichen Leben, möchte ich hinzufügen, verbringen Stunden damit, die Tatsache, dass sie nicht kommunizieren können, zu beklagen. Ich finde, das Geringste, was eine Person tun kann, wenn sie nicht kommunizieren kann, ist den Mund zu halten.“
Heute, ein halbes Jahrhundert später, aber innerhalb der Lebenszeit vieler Menschen, haben sich die Probleme geändert. Die Kommunikation scheitert nicht an der Unfähigkeit der Beteiligten, sondern an den Bedingungen. Wer heute einen Anruf betätigt oder eine Mail schreibt (Briefe dürften nur noch als Relikt der Vergangenheit in Erinnerung sein), wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf einen lebenden Adressaten treffen, sondern auf einen Automaten. Die Kommunikation ist Fiktion. Der Automat reagiert nicht, wie ein Mensch, auf die Ansprache, weil er nur für bestimmte Signale programmiert ist, er versendet vorgefertigte Partikel. Mit Kommunikation hat das so viel zu tun wie der Gebrauch einer Sexpuppe mit Liebe.
Das Telefon verweigert mir ungerührt die Vereinbarung eines Termins. Stattdessen verrät es mir, dass im Moment alle Leitungen besetzt sind, ich aber nicht auflegen soll, weil sich ein Mitarbeiter bei mir melden wird, sobald eine Leitung frei ist. Ich warte, beschallt mit Musik, die nicht unbedingt nach meinem Geschmack ist. Nach zehn Minuten erfahre ich, dass doch keine Leitung frei werde, ich solle es zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen. So vergeht der Tag. Der Automat mutet bereits wie ein enger Verwandter an. Einen Termin freilich habe ich immer noch nicht.
Da will man sich in ein Konto einloggen und erhält, so gewissenhaft man die Vorschriften auch befolgt, vom Computer die herzlose Antwort: „falscher Benutzername oder falsches Passwort“. Widerspruch wird nicht geduldet. Da kann man den korrekten Namen und das richtige Passwort so oft eingeben, wie man will: der Automat kennt nur eine Reaktion. Konnte man seine Anfrage endlich doch deponieren, bekommt man die tröstende Auskunft: „Ein Mitarbeiter wird sich innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen melden.“ Zwei, drei, vier Werktage vergehen, aber kein Mitarbeiter meldet sich, kein Mensch mit Hirn und Herz mischt sich in die Diktatur der Automaten. Die Kommunikation funktioniert noch um Klassen schlechter als zwischen Tom Lehrers liebenden Menschen. Genauer: sie funktioniert gar nicht. Nie werden wir erfahren, ob der Automat die Nachricht überhaupt registriert, ober er sie an einen „Mitarbeiter“ weitergegeben hat.
Orwells 1984 war ein Idyll. Die menschenfreie Automatenwelt, die wir betreten haben und in der aufzugehen wir im Begriff sind, ist im Vergleich dazu die Hölle. Sollen wir sie beklagen wie Lehrers Figuren im Theater und im wirklichen Leben ihre Kommunikationsschwierigkeiten? Wird nichts nützen. „Falscher Benutzername oder falsches Passwort.“
|
Thomas Rothschild - 30. August 2021
2736
|
 Treppenwitz der Geschichte
Treppenwitz der Geschichte
|
Aus der Tschechischen Republik erreicht uns eine aktuelle Meldung:
„In Tschechien bahnt sich eine historische Wende bei der Namensgebung an. Das Abgeordnetenhaus in Prag stimmte am Mittwoch einer Gesetzesnovelle zu, welche Frauen die freie Wahl der männlichen oder weiblichen Form des Nachnamens ermöglicht. Bisher müssen Frauen – wie auch in anderen slawischen Sprachen – einen Familiennamen mit der weiblichen Endung ‚-ova‘ tragen. Wenn der Mann Novak heißt, dann tragen seine Frau und Töchter den Namen Novakova. Doch das könnte sich bald ändern: Für die Änderung stimmten 91 Abgeordnete; dagegen waren 33. Die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, muss dem noch zustimmen.“
Sehen wir einmal davon ab, dass die dpa oder die Zeitungsredaktion entweder über keine diakritischen Zeichen verfügen oder zu unbedarft sind, sie anzuwenden. Die weibliche Endung mit dem langen a schreibt sich á, und Frau Novak war in Tschechien bisher eine Nováková. Der Treppenwitz dieser Meldung besteht darin, dass nun Frauen in Tschechien jenes sprachliche und schriftliche Signal abgeben können sollen, das sie als Frauen „sichtbar“ macht. Früher trugen in vielen Kulturen Frauen sogar den Vornamen ihres Ehemanns. So weit geht man in Tschechien nicht. Aber nach Jahren der verbissenen und anhaltenden Kämpfe um ein unterscheidendes I, * oder / im deutschsprachigen Raum sollen unsere Nachbarinnen auf jenes Differenzierungsmerkmal verzichten dürfen, das ihnen seit je zustand.
Zugegeben: sie werden nicht dazu gezwungen. Sie haben die freie Wahl. Dann aber kommen wir alle in Verlegenheit. Was wollen uns die Frauen von Petr und Pavel Novák mitteilen, wenn die eine Novák und die andere Nováková heißt? Dass sie ihren Gatten inniger oder weniger innig lieben? Dass sie eher dem Feminismus oder der Wahlfreiheit vertrauen? Oder wollen sie sich einfach über jene Deutsch*innen lustig machen, die unterstellen, die Sichtbarkeit und die Emanzipation der Frauen ließe sich durch ein I, ein * oder ein / garantieren. Vielleicht konzentrieren sich Frau Novák und Frau Nováková ja darauf, endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu erkämpfen. Es wäre an der Zeit. Das wäre tatsächlich eine historische Wende, in Tschechien und in Deutschland. Mit und ohne Akzent über dem a.
|
Thomas Rothschild - 3. Juni 2021
2729
|
 Wie es sich fügt
Wie es sich fügt
|
„Der österreichische Nobelpreisträger Peter Handke ist in diesem Frühjahr von seiner Wahlheimat Paris nach Serbien gefahren und hat dort in Freundschaft und Ehrungen geschwelgt. Dreierlei nahm der 79-jährige Autor entgegen, einmal den Ivo-Andrić-Preis (benannt nach dem jugoslawischen Diplomaten und ebenfalls mit dem Nobelpreis gekrönten Schriftsteller), den ‚Orden des Karadjordje-Sterns der ersten Stufe‘ und dann noch den höchsten Orden der Republika Srpska. Das ist jener Teil Bosnien-Herzegowinas, der nach dem Jugoslawien-Krieg durch ethnische ‚Säuberungen‘ nahezu ‚rein‘ serbisch wurde und es, durch völkisch-nationalistische Politik, in weiten Teilen auch geblieben ist.
Handke teilt diesen Preis mit den schriftstellernden Kriegsverbrechern Ratko Mladić und Radovan Karadžić, beide zu lebenslanger Haft verurteilt, sowie dem serbischen Rechtsradikalen Vojislav Šešelj. Auch mit einem Denkmal zu seinen Ehren ließ der Dichter sich würdigen, eine traditionelle Darstellung des Dichters mit allerdings übergroßem Kopf.“ (Elke Schmitter auf Spiegel Online vom 21.05.2021)
Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik (Auswahl): Willy Brandt, Ralf Dahrendorf, Hans Filbinger, Hans-Dietrich Genscher, Hans Globke, Kurt Georg Kiesinger, Henry Kissinger, Helmut Kohl, Norbert Lammert, Angela Merkel, Richard Nixon, Franz Josef Strauß, Wolfgang Thierse, Franjo Tuđman, Lech Wałęsa.
Elke Schmitter nennt ihre Kritik an Handke eine "Einordnung". Zur Einordnung der Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik empfiehlt sich ein exemplarischer Besuch bei den Einträgen zu Franjo Tuđman oder Hans Globke, um sich zu vergewissern, mit wem Willy Brandt, Ralf Dahrendorf oder Angela Merkel ihn teilen. Manchmal hat man Pech mit seinen Nachbarn. Wenn es sich so fügt.
|
Thomas Rothschild – 26. Mai 2021
2727
|
 Dichterische Fantasie
Dichterische Fantasie
|
Wenn Ihrem Club ein Mitglied durch Tod abhanden gekommen ist und Sie nicht recht wissen, wie Sie das an die Öffentlichkeit vermitteln sollen, können Sie sich dieses Textbausteins bedienen:
„Es erreicht uns die traurige Nachricht, dass unser langjähriges Mitglied (xxx) am (xxx) verstorben ist.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“
Er ist eine Spende des PEN Zentrums Deutschland. Da die Altersstruktur des Vereins derart beschaffen ist, dass sich die Nachrufe häufen, findet niemand die Zeit, geschweige denn die Kompetenz und die Empathie, Worte zu entdecken, die dem jeweils Betrauerten angemessen und halbwegs glaubwürdig sind. Über Phrasen kommt man da nicht hinaus. Die schöpferische Beziehung des Dichtervereinsvorstands zur Sprache beschränkt sich darauf, gegebenenfalls die männlichen Pronomina durch weibliche zu ersetzen.
Seien wir ehrlich: Nirgends wird so sehr geheuchelt wie in Nachrufen. Das „de mortuis nilnisi bene“ ist eine unverblümte Aufforderung zur Lüge. Würde man diese Auswüchse rühmender Rhetorik wenigstens zu einem Zeitpunkt formulieren, zu dem sich der derart Gepriesene noch darüber freuen kann. So aber sind sie nicht mehr als ein Akt der Pietät, an den zu glauben einige Überwindung kostet. Besonders krass wird das Misstrauen gegenüber der institutionalisierten Heuchelei, wenn man weiß, wie der Tote, der sich nicht mehr wehren kann, über jene gedacht hat, die jetzt damit drohen, ihm „ein ehrendes Andenken bewahren“ zu wollen.
Die Glaubwürdigkeit wird durch eine versteinerte Sprache der Formeln endgültig torpediert. Da wird ein Pflichtprogramm absolviert. Die Phrasen entlarven die Pharisäer. Dass die Nachricht, die sie erreicht hat, „traurig“ sei, wird man ihnen abnehmen können, wenn sie wenigstens ab und zu zugäben, dass sie eine Todesnachricht gleichgültig belassen oder gar mit Freude erfüllt habe. Und dass sie jemandem „ein ehrendes Andenken bewahren“, soll als überprüfbare Aussage gelten, wenn sie benennen können, worin die Ehrung besteht, und beschwören, dass sie nach drei Monaten noch wissen, wie der Vorname dessen lautete, dessen Andenken sie bewahren wollten.
Ach, diese Scheinheiligern. Ach, diese armselige Sprache, die sie verrät.
|
Thomas Rothschild - 21. April 2021
2723
|
 Hinweis
Hinweis
|
Man muss ja nicht um jeden Preis aussprechen, was andere schon besser, genauer und pointierter gesagt haben. So lange freilich Redakteure und feste freie Mitarbeiter in den bezahlenden Medien davon profitieren, werden sie weiterhin daherschwadronieren, als besäßen sie ein Denkvermögen. Nicht das Plagiat ist das Ärgernis, sondern die Geschwätzigkeit, die uns wertvolle Lebenszeit stiehlt. Weil es aber ein Manko wäre, wenn ein wirklich brillanter journalistischer Beitrag einer Autorin, die mir bislang nicht aufgefallen ist und auf deren Text ich nur durch Zufall gestoßen bin, in den Abgründen des Internets verloren ginge, sei heute anstelle einer eigenen Herzensergießung auf einen Link verwiesen. Wer ihn anklickt [s. auf 54books.de], wird es nicht bereuen: Früher einmal hieß es in so einem Fall: „Den Namen wird man sich merken müssen.“ Es wäre schon etwas gewonnen, wenn man den von Christina Dongowski genannten Namen in den Kontext rückte, den sie so treffend charakterisiert. Der folgende Satz jedenfalls hat das Zeug zu einem „Klassiker“ des politischenAphorismus: „Bloß gehört die schlichte Erkenntnis, dass Leute, die freiwillig Nazi-Kunst machen, auch Nazis sind, eben noch immer nicht zu den Basics deutscher Debatten.“
|
Thomas Rothschild - 16. Januar 2021
2713
|
 Die Schamlosigkeit unter Freunden
Die Schamlosigkeit unter Freunden
|
Der ORF veröffentlicht seit bald 18 Jahren eine Bestenliste, die das Modell der sehr viel älteren SWR-Bestenliste kopiert. So manche(r) mag sich darüber wundern, dass sich die beiden Listen Monat für Monat so sehr unterscheiden, wieso es kaum zu Überschneidungen kommt. Das Rätsel ist schnell gelöst. Einige von den (österreichischen) Juroren der ORF-Liste nominieren ausschließlich oder bevorzugt österreichische Autorinnen und Autoren. Wenn das gewünscht würde, müsste man die Liste – im Unterschied zur Liste des SWR – Liste der besten Bücher von Österreichern nennen. Das aber ist nicht der Fall. Auf der Homepage steht eindeutig: „Die besten Bücher des Monats“.
Im Januar 2021 ist Die unaufhörliche Wanderung von Karl-Markus Gauß laut ORF-Liste das beste Buch. Besser als Gustave Flaubert und Richard Ford, besser als Ali Smith und Ivo Andrić. Thomas Kling oder Maria Stepanova, die auf der gleichzeitig veröffentlichten Bestenliste des SWR stehen, haben es in Österreich gar nicht erst auf die Liste geschafft. Gibt es dafür benennbare Gründe? Gauß ist ohne Zweifel ein lesenswerter Autor, anerkannt auch in Deutschland, aber der Beste oder auch nur einer der zehn Besten im Vergleich mit den Neuerscheinungen der vergangenen Monate aus aller Welt?
Der Siegername freilich überrascht nicht. Mit beachtlicher Zuverlässigkeit gelangen die Bücher von Karl-Markus Gauß auf die ORF-Bestenliste und klettern bis auf den ersten Platz. Dazu sollte man allerdings wissen: Karl-Markus Gauß ist Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik. Er entscheidet, wer in dieser Zeitschrift publizieren darf, er hat die Macht, zu bestrafen und zu belohnen, und er macht Gebrauch davon. Von den sechs Juroren, die Karl-Markus Gauß aktuell nominiert haben, sind drei regelmäßige Mitarbeiter von Literatur und Kritik, ein vierter leitet eine befreundete Literaturgesellschaft.
Solch eine Nominierung hat das Gschmäckle von Provinzialismus und Nepotismus. Dass Korrumpierbarkeit zum österreichischen Nationalcharakter gehört, weiß man nicht erst, seit ein H.C. Strache nach Ibiza reist. Das Schlimmste ist, dass die Beteiligten noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben. Sie halten vielmehr jene, die Hemmungen haben, für Trottel. Schamlosigkeit ist in Österreich so alltäglich wie der Veltliner und das Wiener Schnitzel. Und so empfiehlt die ORF-Bestenliste nicht die besten Bücher, sondern die ziemlich besten Freunde. Wäre ich Gauß, würde ich mich gegen solche „Gefälligkeit“ verwahren. Aber ich habe Österreich vor 53 Jahren verlassen. Die Gepflogenheiten meiner Heimat sind mir fremd geworden. Die ORF-Bestenliste erinnert mich ein Mal im Monat an sie.
|
Thomas Rothschild - 8. Januar 2021
2711
|
 Korrektur
Korrektur
|
Theatergänger und Schauspieler kennen das Phänomen. Das Lob des guten Menschen, allen voran des Gottessohnes Jesus Christus, mag in der Sonntagsmesse seinen Platz haben. Auf der Bühne sind es in der Regel die Schurken, die das Publikum faszinieren (und von den Schauspielern bevorzugt gespielt werden). Von Richard III. bis Puntila, von Mephisto bis zu Jack dem Ripper, von Lady Macbeth bis Claire Zachanassian sind es die Bösewichte beiderlei Geschlechts, die unser voyeuristisches Vergnügen anstacheln, auch wenn wir ihnen im wirklichen Leben ungern begegneten.
Aber es gibt sie auch in der Weltliteratur, die liebenswerten Männer und Frauen, die das Herz erwärmen, ohne dass sie deshalb fade wären. Das verdankt sich in der Regel kleinen Unzulänglichkeiten, mit denen sie ihre Autoren ausgestattet haben und die sie erst richtig menschlich machen. Erinnern wir uns an Samuel Pickwick von Charles Dickens, an den Fürsten Myschkin von Fjodor Dostojewski, an Tatjana Larina von Alexander Puschkin, an Pierre Besuchow und Natascha Rostowa aus Tolstois Krieg und Frieden, an Gorkis und Brechts Pelagea Wlassowa. Sie passen nicht in das Schema von dem tyrannischen Mann und der unterdrückten Frau, denen das gegenwärtige Interesse gehört, als müsste mit jeder Magisterarbeit und jedem Feuilleton nachgewiesen werden, was ja zutrifft, was wir aber auch wissen: dass wir seit Jahrhunderten in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. Auch Samuel Pickwick ist von ihr geprägt, aber man täte ihm und Dickens unrecht, wenn man ihn darauf reduzierte. Gerade die Zuneigung zu dieser aimablen und schrulligen Figur ermöglicht das Lächeln über ihre Schwächen, das frei ist von Spott und Bitternis.
In der Gegenwartsliteratur sind solche Männer und Frauen selten geworden. Über ihr lauert, nicht ohne Berechtigung, der Kitschverdacht. Und doch: selbst bei einem Sarkastiker wie Thomas Bernhard findet man liebenswerte (und kauzige) Männer nach dem Vorbild von Glenn Gould oder Paul Wittgenstein, und Erich Hackl ist geradezu abonniert auf bewundernswerte, größtenteils starke Frauen.
Erich Kästners berühmte Gedichtstrophe hat ja nichts von ihrer Gültigkeit verloren:
"Und immer wieder schickt ihr mir Briefe,
in denen ihr, dick unterstrichen, schreibt:
´Herr Kästner, wo bleibt das Positive?`
Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt."
Aber dieser realistische Blick impliziert kein Verbot von literarischen Figuren, denen unsere Sympathie gehört. Vielleicht benötigen wir sie, die heutigen Pickwicks und Nataschas, gerade, weil wir in den Nachrichten Trump und Orbán verdauen müssen. Als Korrektur. Wenigstens ab und zu.
|
Thomas Rothschild - 4. Dezember 2020
2707
|
 Kämmerlings, setzen!
Kämmerlings, setzen!
|
In der Welt am Sonntag tönt der Mitarbeiter der Literarischen Welt Richard Kämmerlings: „Isaak Babel wurde zum Whistleblower der Reiterarmee, der Kriegsverbrechen trotz notdürftiger Fiktionalisierungen offenlegt.“ Das ist, freundlich formuliert, schlicht gedacht. Es ist aber darüber hinaus eine niederträchtige Schmähung eines Schriftstellers, den man mit gewissem Recht den bedeutendsten Verfasser von Kurzprosa im 20. Jahrhundert nennen darf. Nichts an Babels Reiterarmee ist „notdürftig“. Was der deutsche Leser auf Grund der früheren Übersetzungen noch übersehen mochte, ist seit Peter Urbans Übertragung auch für ihn zumindest erahnbar: Babel war ein Sprachkünstler, wie es selbst außerhalb Russlands kaum einen zweiten gibt, und was ein Kämmerlings, bei dem man ausnahmsweise bedauert, dass sich Wortspiele mit Eigennamen verbieten, für „notdürftige Fiktionalisierung“ hält, ist Literatur im strengsten Wortsinn. Isaak Babel zum „Whistleblower“ zu reduzieren, als hätte er sich vorgenommen, mit seinen Geschichten die Welt aufzurütteln, gleicht dem dreisten Versuch, Tolstoj als Kriegskorrespondenten oder Kämmerlings als Literaturkritiker zu kategorisieren. Babels Reiterarmee zeichnet sich gerade durch ihre Ambiguität aus, durch einen Stil, der den Autor von einem Snowden oder Assange, wie immer man zu ihnen stehen mag, nicht weniger unterscheidet als der Verstand einen tatsächlichen Literaturkritiker wie, sagen wir, Heinrich Vormweg von einem Welt-Schwätzer wie Richard Kämmerlings. Womit wir allerdings nichts Neues entdeckt und verraten haben. Wir können also noch nicht einmal Anspruch auf das Attribut des Whistleblowers erheben.
|
Thomas Rothschild - 25. November 2020
2706
|
 Und wieder zweierlei Maß
Und wieder zweierlei Maß
|
Zur Erinnerung: zahllose Autorinnen und Autoren des Rowohlt Verlags protestierten gegen die Veröffentlichung der Autobiographie von Woody Allen, gegen den Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Ein paar Monate später: zahllose Autorinnen und Autoren protestieren gegen die Nicht-Veröffentlichung eines Romans von Monika Maron, die einen Essayband im rechtsradikalen Umfeld publiziert und mehrfach Meinungen geäußert hat, die man schwerlich anders als rechtsextrem klassifizieren kann. Kurios ist es jedenfalls, wenn die Teilnahme von rechtsradikalen Verlagen an der Frankfurter Buchmesse getadelt wird, es aber ohne Folgen bleiben soll, wenn man sich als Autor zu ihnen bekennt.
Ja was nun? Es gehört zur Freiheit der Rede und zur Freiheit der Kunst, dass man auch unbequeme und anstößige Ansichten öffentlich äußern kann. Es gehört auch zur Freiheit der Rede und zur Freiheit der Kunst, dass ein Verlag entscheiden kann, was er veröffentlichen möchte und was nicht. Einer Monika Maron stehen tausende Autorinnen und Autoren gegenüber, deren Manuskripte von Verlagen abgelehnt werden und deren Namen wir nie erfahren. Dass Maron zum Stamm von S. Fischer gehört, verpflichtet den Verlag ebenso wenig, ihr bis zum Lebensende die Treue zu bewahren, wie Autorinnen und Autoren zu einer lebenslangen Bindung an einen Verlag verpflichtet sind. Man kennt die Beispiele von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die, kaum dass sie Erfolg hatten, dem Kleinverlag, der sie entdeckt und gefördert hat und angewiesen ist auf Einkünfte aus Büchern von arrivierten Autoren, den Rücken kehren und zu einem kapitalkräftigen Verlag wechseln, der effizientere PR anbieten kann.
Immerhin: es gibt diese Kleinverlage, noch, und es gibt in unseren Breiten eine beachtliche Anzahl von größeren Verlagen. Monika Maron ist das beste Beispiel für die Tatsache, dass eine – zumal etablierte – Schriftstellerin in kürzester Zeit einen anderen Verlag findet, wenn ihr ihr Stammhaus die Zusammenarbeit kündigt. Wenn Hoffmann und Campe jetzt die Vorwürfe zu hören bekommt, die sich S. Fischer ersparen wollte, mögen die Autorinnen und Autoren, die Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Medien Gründe zur Verteidigung finden, die mindestens so überzeugend sind wie die Gründe für eine Ablehnung von Woody Allens Autobiographie.
|
Thomas Rothschild - 15. November 2020
2704
|
 Zugehörig
Zugehörig
|
Der Schriftsteller Arthur Schnitzler schrieb einmal: „Ich fühle mich mit niemandem solidarisch, weil er zufällig derselben Nation, derselben Rasse, derselben Familie angehört wie ich. Es ist ausschließlich meine Sache, mit wem ich mich verwandt zu fühlen wünsche; ich anerkenne keine angeborene Verpflichtung in dieser Frage.“ Dass man selbst entscheidet und sich nicht von seiner Umwelt aufschwätzen lässt, wem man sich zugehörig zu fühlen habe, wäre schon ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Status quo. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Warum muss man sich überhaupt einem Kollektiv zugehörig fühlen? Woher stammt dieser scheinbar unwiderstehliche Drang, sich einer Nation, einer Rasse, einer Familie verwandt zu fühlen? Ist es nicht auch dort, wo man keine Verpflichtung anerkennt und selbst entscheidet, mit wem man sich verwandt zu fühlen wünscht, der gesellschaftliche Druck, der einem solch eine Entscheidung abverlangt?
Der Fortschritt im Sinne der Vernunft und der Aufklärung bestünde darin, dass man sich frei macht von dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit, zu wem auch immer, dass man sich vom internalisierten Herdentrieb löst, kurz: dass man auf der Differenz zwischen Menschen und Graugänsen insistiert. Das pädagogische Ziel bestünde darin, schon bei Kindern die Ich-Stärke zu fördern, die Fähigkeit zu „einsamen“ Entscheidungen und das Vertrauen auf die eigene Intelligenz. Dies ist kein Plädoyer für einen Individualismus der Rücksichtslosigkeit. Aber man muss sich nicht als Teil eines Kollektivs verstehen, um die Rechte anderer zu respektieren. Man muss seine Verantwortung nicht delegieren, sich weder eine Parteidisziplin, noch eine geheuchelte Loyalität aufdrängen lassen, um unheilvolle Kontroversen innerhalb der Gemeinschaft zu vermeiden oder auch nur zu verringern. Die Problematik, die zwischen den Weltkriegen brisant war, hat unter anderem Bertolt Brecht bei den Fassungen seines Stücks Mann ist Mann umgetrieben. Wo man sich über die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv definiert, durch seine Nation, seine Rasse, seine Familie oder auch durch seine Anhängerschaft für einen Fußballverein, seine politische Gruppierung, seine Vorliebe für irgendwelche Hobbys, ist die Möglichkeit des Konflikts mit anderen Kollektiven und jenen, die sich ihnen ihrerseits zugehörig fühlen, vorprogrammiert.
Es wäre schon ein Fortschritt, wenn man sich den Wunsch nach Zugehörigkeit als Schwäche eingestände. Leider sind wir noch weit davon entfernt. Wenn jemand die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv mit mehr oder weniger guten Gründen aufkündigt, begibt er sich im Normalfall nicht in die Selbstbestimmung, sondern in eine neue Zugehörigkeit. Das ist das Muster, das der Konvertit und der Renegat vormachen. Er tauscht die eine Glaubensgemeinschaft gegen eine andere aus. Nur selber denken kann und will er nicht. Sein Verhalten taugt nur zur Verlängerung eines Missstandes. Der autobiographische Roman von Arthur Schnitzler trägt den Titel: Der Weg ins Freie. Er ist noch lange nicht beschritten.
|
Thomas Rothschild - 12. November 2020
2703
|
 Richter ohne Richter
Richter ohne Richter
|
In der Stuttgarter Zeitung vom 06.08.2020 befragt deren Literaturredakteur Stefan Kister die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach Sandra Richter über die gegen sie erhobenen Vorwürfe [s. Karlsruhe, Marbach und überall]. In dem Interview heißt es unter anderem mit Bezug auf die vernachlässigte Präsenzpflicht:
„Was spricht eigentlich dagegen, nach Marbach zu ziehen?
In modernen Familien kommt es vor, dass beide Teile an verschiedenen Orten sind. Die gegenwärtige Lebenssituation ist sicher nicht auf Dauer angelegt, langfristig möchte ich mich in Richtung Süden verändern. Zurzeit geht das noch nicht. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. Aber ich habe eine Zweitwohnung in nächster Nähe zum Archiv, in der sich gerade meine Kinder aufhalten, und hoffentlich nichts anstellen.“
Sandra Richter hatte von 2008 bis zum Amtsantritt in Marbach einen Lehrstuhl an der Universität Stuttgart inne. Das ist immerhin ein gutes Jahrzehnt. Stuttgart liegt 25 Kilometer von Marbach entfernt und ganz entschieden im Süden Deutschlands. Haben 12 Jahre nicht ausgereicht, um sich langfristig in Richtung Süden zu verändern? Und bleiben die Absenzen vom Dienst in Forschung und Lehre, ausgefallene Vorlesungen, Seminare und Sprechstunden ohne Folgen? Offenbar. Die beteiligt waren an Berufungen nach Stuttgart, Marbach oder sonst wo hin, haben kein großes Interesse daran, dass die Berufenen kritisiert werden. Dass sie diese gegenüber Vorwürfen verteidigen, ist kaum verwunderlich. Es ist in ihrem Interesse. Man könnte sonst auf die Idee kommen, zu recherchieren, wie sehr sie sich über die Kandidaten im Wissenschafts- oder im Kunstbereich kundig gemacht haben. Aber die Medien dürften schon genauer nachhaken. Etwas mehr sollte dem Redakteur der Stuttgarter Zeitung schon einfallen als die Frage: „Hatten Sie nicht zuletzt manchmal Lust, das Ganze hinzuschmeißen und an die Universität zurückzukehren?“ Damit Sandra Richter dort langfristig fortsetzt, womit sie in Marbach möglicherweise – wohl aber doch nicht – gescheitert ist? Für alle Fälle hat sie sich das Recht zur Rückkehr an die Universität gesichert, und das Ministerium hat ihrem Begehr entsprochen. Hängt alles nur davon ab, worauf Sandra Richter manchmal Lust hat? Die Affäre scheint ja wohl mehr zu sein als ein „Pausenfüller für das Sommerloch“.
|
Thomas Rothschild - 5. August 2020
2693
|
 Stellenausschreibung
Stellenausschreibung
|
Wir weisen unsere Leser auf eine Stellenausschreibung des deutschen PEN-Zentrums hin. Gesucht wird ein Angestellter für die Projektkoordination Writers in Prison und literarisches Leben. Verlangt wird folgende Qualifikation:
"Sie können ein abgeschlossenes Studium vorweisen oder haben eine Verwaltungsfachausbildung / kaufmännische Ausbildung erfolgreich absolviert
- Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, bspw. als Vorstands- oder Geschäftsführungsassistenz
- Sie haben eine ausgeprägte Zahlenaffinität, verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und können sich zügig in komplexe Sachverhalte einarbeiten
- Sie verfügen über Erfahrungen in der Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln/Förderanträgen und im Vergaberecht
- Sie kennen sich in der Vereins- oder Verbandsarbeit aus
- Sie haben Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen oder Tagungen
- Sie zeichnen sich durch eine proaktive, selbständige und strukturierte Arbeitsweise aus und behalten Ihr souveränes Auftreten auch in Stresssituationen
- Sie verstehen es, auf verschiedenen Ebenen zielgerichtet zu kommunizieren
- Sie sind ein Teamplayer, bringen ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen mit, sind offen für Neues, konfliktfähig und flexibel
- Die Menschenrechte liegen Ihnen am Herzen
- Wünschenswert sind gute Kenntnisse des deutschen Literaturbetriebs
- Fremdsprachenkenntnisse erwünscht
- Gender- und Diversitätskompetenz setzen wir voraus"
Selbstverständlich darf davon ausgegangen werden, dass die Mitglieder des PEN-Vorstands, allen voran die Präsidentin Regula Venske und der Generalsekretär Heinrich Peuckmann, über die Qualifikationen verfügen, die sie von einer abhängigen Mitarbeiterin, einem abhängigen Mitarbeiter (3367,04 Euro Monatsgehalt) erwarten. Alles andere wäre mit den hehren Ansprüchen des Vereins kaum vereinbar. Schon wegen der Diversitätskompetenz oder so. Obwohl, wenn man‘s genau bedenkt: die Damen und Herren des Vorstands sind ja damit beschäftigt, Weltliteratur zu produzieren. Da kann man von einer Projektkoordinatorin, einem Projektkoordinator schon etwas mehr verlangen. Irgendwer muss die Arbeit schließlich erledigen. Mit ausgeprägter Zahlenaffinität (um es in angemessen literarischer Sprache auszudrücken).
|
Thomas Rothschild - 25. Juli 2020 (2)
2692
|
 Arno Widmann und der Rassismus
Arno Widmann und der Rassismus
|
In der Berliner Zeitung reist Arno Widmann, der langjährige Reisende durch die deutschen Feuilletons, „durch die Kulturgeschichte des Rassismus“. Nach mancherlei Bedenkenswertem gelangt er zu der apodiktischen Behauptung: „Es gibt keine Reinheit. Sie einzufordern ist selbst Rassismus.“ Diese verblüffende, aber in ihrer Rhetorik ziemlich ausgelutschte Pointe folgt dem Muster der Kinderreplik „das bist du und was bin ich“ auf die Beschimpfung als Esel oder als Trottel. Die Forderung nach Reinheit – in diesem Zusammenhang: der Ideen, der Gedanken – mag unsinnig sein oder beschissen, unproduktiv oder verbohrt. Mit Rassismus hat sie so viel zu tun wie die Forderung von Logik mit Pädophilie.
Widmann müsste nur seinen eigenen Artikel lesen. Dort zitiert er gleich zu Beginn eine brauchbare Definition von Rassismus. „Wenn Menschen nicht nach ihren individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften oder danach, was sie persönlich tun, sondern als Teil einer vermeintlich homogenen Gruppe beurteilt und abgewertet werden, dann ist das Rassismus.“ Was hat die Forderung von Reinheit der Ideen – an Kant oder an sonst wen – mit der Beurteilung und Abwertung von Menschen als Teil einer vermeintlich homogenen Gruppe zu tun? Nichts. Aber indem Widmann den Kritikern von Rassismus unterstellt, sie seien selbst Rassisten, setzt er diese ohne weitere Argumente ins Unrecht und eskamotiert zugleich die Kategorie des Rassismus aus der Debatte.
Es gibt gute Gründe dafür, das Denken in seiner Widersprüchlichkeit auszuhalten, ja gerade „das zu mögen“. Es gibt schlagende Argumente gegen die Beseitigung von verstörenden Erinnerungen und damit auch der Herausforderung, sich mit ihnen (kritisch) auseinanderzusetzen. Aber die undifferenzierte Einebnung von Begriffen ist dabei nicht hilfreich. Wer alles, was ihm oder ihr nicht gefällt, zu Rassismus macht, beraubt den Rassismus seiner spezifischen Bedeutung. Er bedarf dann ebenso wenig der Ablehnung und der Bekämpfung wie die Schwerkraft.
Ist es das, was Arno Widmann bezweckt? Wohl nicht. Eher schon als Absicht ist sein Sermon Gedankenlosigkeit. Auch eine Möglichkeit, der Verunreinigung von Gedanken zu begegnen.
|
Thomas Rothschild - 7. Juli 2020
2688
|
 Gesinnung und Literatur
Gesinnung und Literatur
|
Als Rolf Hochhuth neulich starb, taten die Nachrufe, was zu ihrem Wesen gehört: Sie hoben den Schriftsteller in einen Himmel, in dem anzukommen die Autoren dem Toten wohl wünschten. Nur sehr vorsichtig mischten sich in einige Nekrologe kritische Worte.
Die Wahrheit ist: Hochhuths Bedeutung lag in der Erinnerung an die politische Schuld des Stellvertreters Jesu Christi, in der Aufdeckung der Vergangenheit des „furchtbaren Juristen“ Hans Filbinger. Als Dramatiker war er von geringer Bedeutung. Für das Dokumentardrama, für das ihn manche Nekrolog-Schreiber lobend erwähnten, haben etwa Heinar Kipphardt oder Peter Weiss ungleich mehr geleistet, jedenfalls wenn es um Literatur und nicht bloß um Skandale geht. Zugespitzt ließe sich formulieren: mit Hochhuth hat die sich bis heute steigernde Tendenz begonnen, Themen für wichtiger zu halten als ästhetische Verfahren. Kritiker wie Heinrich Vormweg, Reinhard Baumgart oder Jörg Drews wussten noch Bescheid. Durchgesetzt hat sich Reich-Ranicki.
2015 hat die weißrussische Journalistin Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch den Literaturnobelpreis erhalten, dessen sich für das Stockholmer Komitee weder Tolstoi, noch Tschechow, noch Gorki, noch Achmatowa, noch Mandelstam, noch Zwetajewa, noch Babel als würdig erwiesen haben. Jetzt bekommt Ljudmila Jewgenjewna Ulitzkaja den Siegfried Lenz Preis, nachdem sie bereits mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur, geehrt wurde. (Was das über den Namensgeber Siegfried Lenz besagt, wäre eine eigene Überlegung wert.)
Beide, Alexijewitsch wie Ulitzkaja, haben sich durch couragierten Widerstand gegen Unrecht in Russland und gegen Putin Ansehen erworben und verdienen dafür jeglichen Respekt. Jeder Preis für politischen Mut wäre in beiden Fällen angemessen. Aber auch hier gilt: literarisch, künstlerisch, sprachlich sind beide, nicht nur innerhalb der russischen Literatur, allenfalls Autorinnen der Mittelklasse. Das können auch Jubelrezensionen und Laudationes nicht verschleiern. Ihre Verfasser machen sich allenfalls zu Komplizen eines Literaturbetriebs, dem es auf Literatur nicht mehr ankommt. Dass Literaturkritiker, die Romane danach beurteilen, was sie aus ihnen über die Wirklichkeit erfahren, Ljudmila Ulitzkaja loben, ist nicht weiter verwunderlich. Erstaunlicher ist schon, dass selbst Rezensenten, die ansonsten größten Wert auf die (sprachliche) Beschaffenheit von Literatur legen, plötzlich ins Schwärmen geraten, wenn sie über diese Autorin zu schreiben haben.
Man leistet der Literatur keinen Dienst, wenn man die Kriterien missachtet, die sie erst konstituieren, und stattdessen Literaturpreise für Gesinnung und Haltung vergibt. Damit trägt man bei zur Marginalisierung der Künste, zur Zerstörung der Wahrnehmung dessen, was Literatur ausmacht und von Journalismus oder politischem Aktivismus unterscheidet. Albert Einstein hatte viele Qualitäten und Fähigkeiten. Den Nobelpreis hat er für Physik erhalten. Und das ist gut so.
|
Thomas Rothschild - 17. Juni 2020
2685
|
 Super-Superlativ
Super-Superlativ
|
Zwei Mal im Jahr flattern – na ja, flattern ist angesichts des manchmal beträchtlichen Gewichts das falsche Verb –, neuerdings immer häufiger digital, die Kataloge der Verlage ins Haus. Dieser Tage traf die Herbstvorschau von Suhrkamp ein. Sie hat eindrucksvolle 180 Seiten. Da erfahre ich:
„Durs Grünbein, geboren 1962 in Dresden, ist einer der bedeutendsten und auch international wirkmächtigsten deutschen Dichter und Essayisten.“
„Maria Stepanova ist die maßgebliche russische Gegenwartsautorin von weltliterarischem Rang.“
„Marie-Claire Blais, geboren 1939 in Québec, ist eine der maßgeblichen Autorinnen Kanadas.“
„Annie Ernaux (…) ist eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit.“
„Paul Celan (…) gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter nach dem Zweiten Weltkrieg.“
„Elsa Dorlin (…) gilt als eine der führenden französischen feministischen Theoretikerinnen der Gegenwart.“
„Judith Butler ist die kreativste und mutigste Sozialtheoretikerin unserer Tage.“
Jonathan Lears Radikale Hoffnung ist „eines der tiefgründigsten und elegantesten Bücher der letzten Jahrzehnte.“
„Adam Przeworski, geboren 1940 in Warschau, gilt als einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler der Gegenwart.“
„Heiner Müller (1929-1995) war einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker und Theaterregisseure nach 1945.“
„Isabel Allende, geboren 1942 in Lima, ist eine der weltweit beliebtesten Autorinnen.“
„Adrian McKinty, geboren 1968 in Belfast, zählt zu den wichtigsten irischen Krimiautoren.“
„Joanna Bator, 1968 geboren, gilt als eine der wichtigsten neuen Stimmen der europäischen Literatur.“
Uff. Nun könnte man diesen Überbietungszwang als Einbruch der Sprache der Waschmittelwerbung in den literarischen Diskurs abbuchen. Aber ganz so harmlos, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, ist solcher Superlativismus nicht. Wo die eigenen Angebote derart über den grünen Klee gelobt werden, wird alles Übrige unterschwellig als zweit- oder drittrangig denunziert. Es kann ja nicht nur wichtigste und bedeutendste oder gar wirkmächtigste Autorinnen und Autoren geben. Das würde den Superlativ seines vergleichenden Sinns berauben. Die Häufung von Superlativen ebnet die Unterschiede ein und besagt am Ende gar nichts mehr. Wie überraschend und zugleich erholsam wäre es, wenn der Verlag einen Autor mit den Worten vorstellte, er sei nicht ganz so bedeutend, seine Bücher seien nicht ganz so wichtig. Es verliehe dem Lob an anderer Stelle wieder Gewicht.
Damit wir uns nicht missverstehen. Was hier dokumentiert wurde, ist keine Besonderheit des Suhrkamp Verlags. Es gilt für (fast) alle Kataloge, die jedes Halbjahr ins Haus flattern. Ein schwacher Trost. Die Lust am Superlativ zählt zu den dümmsten und verzichtbarsten Unsitten der Selbstanpreisung.
Ein jüdischer Witz erzählt von dem Friseur in der Lowe East Side, der eine Tafel an seine Tür hängt: „Der beste Friseur in New York.“ Sein Nachbar, erbost, hängt eine Tafel an seinen Laden: „Der beste Friseur in Amerika.“ Ein weiterer Nachbar kontert: „Der beste Friseur in der Welt.“ Daraufhin hängt ein Vierter eine Tafel aus: „Der beste Friseur in der Straße.“
|
Thomas Rothschild - 23. Mai 2020
2681
|
 Meinungen
Meinungen
|
Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers war ein eklatantes Beispiel. Als er erschienen war, begegnete man immer wieder Menschen, die eine dezidierte Meinung zu Walsers Buch hatten. Die einen hielten den Roman für antisemitisch, die anderen wiesen diesen Vorwurf vehement zurück. Nur eins hatten sie gemeinsam: Sie hatten das Buch nicht gelesen. Die einen sind geneigt, Walser für einen Antisemiten zu halten, weil das in das Bild passt, das sie sich seit der Paulskirchenrede von 1998 von diesem Autor machen. Die anderen lehnen diesen Verdacht von vornherein ab, weil sie Walser, wie sie ihn von früher her kennen, Antisemitismus „nicht zutrauen“.
Nun kann man Walsers Roman durchaus unterschiedlich lesen. Man kann auf Grund der Lektüre zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, auch wenn jeder seine eigene Interpretation für die einzig gültige und die entgegengesetzte für das Resultat schlampigen Lesens halten mag. Dabei spielen gewiss eigene Erfahrungen, Assoziationen, Idiosynkrasien, auch tatsächlich Missverständnisse eine Rolle. Nur eins kann man nicht: sich eine Meinung bilden, ohne den Gegenstand zu kennen, auf den diese sich bezieht. Es scheint mehr und mehr zur Mode zu werden, dass man Menschen weniger danach beurteilt, was sie tun und sagen, sondern danach, was man ihnen – im Guten wie im Bösen – „zutraut“. Das ist bequem. Aber auch ungerecht.
Die Paarung von Meinungsfreude und Informationsfaulheit geht aber noch weiter und wird von den Medien fortwährend unterstützt. Denn sie betrifft nicht nur Objekte, über die man, wie im Fall von Walsers Roman, unterschiedlich urteilen kann. Sie erstreckt sich auch auf Themen, die sich einer Meinungsäußerung entziehen. Eine Meinungsumfrage, ob der vergangene Sommer ungewöhnlich heiß gewesen sei, ist purer Unsinn. Die Antwort ist keine Sache der Meinungen, sondern der (messbaren) Fakten. Für sie ist das Statistische Zentralamt zuständig oder eine meteorologische Institution, nicht eine plebiszitäre Mehrheit. Abfragen lässt sich allenfalls, ob die Menschen den Sommer als ungewöhnlich heiß empfunden haben, nicht, ob er es tatsächlich war. Und wie wenig man sich auf Empfindungen verlassen kann, darüber belehrt uns die alltägliche Erfahrung ebenso wie die wissenschaftliche Psychologie.
Täglich aber werden, auch in seriösen Zeitungen, Meinungen abgefragt, wo es um Fakten geht. Jeder kann ja eine Meinung haben. Sich über Fakten zu informieren, ist manchmal aufwendig. Nur: ein Stein fällt, wenn man ihn loslässt, zur Erde, auch wenn eine Mehrheit der Meinung ist, er müsste nach oben fallen. Und die Zahl der Arbeitslosen wird nicht kleiner oder größer, wenn die bei einer Meinungsumfrage ermittelte Zahl von jener abweicht, die sich durch mehr oder weniger zuverlässige Statistiken nachweisen lässt. Auch die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus unterliegen nicht Meinungen, sondern überprüfbaren Tatsachen, die allenfalls noch nicht hinreichend erforscht sind. Man kann eine Meinung darüber haben, wie eine bevorstehende Wahl ausgehen wird. In dem Augenblick aber, in dem die Stimmen ausgezählt sind, ist solch eine Meinung irrelevant. Sie ist ebenso belanglos wie die Meinung, dass die Erde eine Scheibe sei, und die Erfahrung lehrt uns, dass jene Institutionen, die mit viel Geld und viel Aufwand Meinungen zu erforschen vorgeben, häufig schon zuvor schief lagen. Wer meint, dass der Evolution ein intelligentes Design zugrunde läge, mag sich darauf berufen, dass das Gegenteil nicht beweisbar sei. Sie ist genauso wenig widerlegbar wie die Meinung, dass auf jedem Schreibtisch ein unsichtbares Männchen sitze, das einem über die Schulter schaue. Bis zum Ausgang einer Wahl ist auch die Meinung nicht beweisbar, dass eine bestimmte Partei die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten werde. Dass sie falsch ist und immer falsch war, beweist erst das Wahlergebnis.
Man sollte also aufhorchen, wenn jemand mit Nachdruck und erhobenen Hauptes erklärt, er habe zu einer Sache eine Meinung. Geht es tatsächlich um etwas, das unterschiedliche Meinungen zulässt, oder camoufliert die vorgetragene Äußerung lediglich einen Mangel an Wissen?
Eine neuere Entwicklung ist übrigens, dass jeder, der eine Meinung in den Medien äußern darf oder gar eine Stelle an einer Fachhochschule besetzt, Philosoph genannt wird. Mit Odo Marquard, Jean-Paul Sartre, Karl Popper oder gar Immanuel Kant haben sie zwar weniger gemeinsam als mit jedem beliebigen Zeitungskolumnisten, aber ihr Geschwätz wird durch die Berufsbezeichnung geadelt. Als hielte man den Buchhalter von der Kleinfirma um die Ecke für einen Mathematiker. Bringt uns das weiter?
Ich meine ja nur...
|
Thomas Rothschild - 27. April 2020
2675
|
 Corona bringt es an den Tag
Corona bringt es an den Tag
|
Man traut seinen Ohren nicht. Die FDP, ausgerechnet, hat Keynes für sich entdeckt. Der liberale Politiker Michael Theurer verlangt eine staatliche Entschädigungen für diejenigen, die unter den Folgen der aktuellen Beschränkungen leiden: „Die Solidargemeinschaft braucht das Herunterfahren, die Solidargemeinschaft sollte auch gemeinsam die Kosten tragen." Er sagt „Solidargemeinschaft“ und meint, sofern er die Kosten im Auge hat, den Staat, dessen Einmischung sich die FDP in besseren Zeiten, in Zeiten also, da Profite gescheffelt wurden, mit Nachdruck verbeten hat. An eine einmalige Vermögensabgabe von besonders wohlhabenden Bürgern, wie sie die Linkspartei und die SPD fordern, dürften Theurer und seine FDP beim Begriff „Solidargemeinschaft“ jedenfalls nicht gedacht haben. Schon vor elf Jahren wunderte sich die konservative Zeitung Welt anlässlich einer Äußerung des damaligen FDP-Wirtschaftsministers Rainer Brüderle: „Dass sich gerade die FDP auf Keynes beruft, ist originell. Schließlich standen die Liberalen bislang dem Ansatz dieses Ökonomen, der für eine starke Rolle des Staates im Kampf gegen Rezession und Arbeitslosigkeit plädiert hatte, überaus kritisch gegenüber.“
Mit großer Aufgeregtheit berichten die Medien jetzt, wie hoch die Verluste der deutschen Wirtschaft seien, die auf das Konto des Coronavirus gehen. Die Zahlen sind aufschlussreich. Sie verraten die Höhe der Gewinne, die vor dem Ausbruch des Virus Monat für Monat gemacht wurden, abzüglich der Gewinne, die auch jetzt noch gemacht werden. Es herrscht ja kein totaler Produktionsstillstand. Meldungen wie die folgenden gehen in den lautstarken Jeremiaden unter: „Eine starke Nachfrage nach Waren des täglichen Bedarfs hat den deutschen Einzelhändlern zu Beginn der Corona-Krise einen Umsatzsprung beschert. Ihre Einnahmen wuchsen im Februar um nominal 7,7 Prozent zum Vorjahresmonat und damit so kräftig wie seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr.“ Und der Spiegel jubelt mitten in die Untergangsstimmung hinein: „Doch offensichtlich verkaufen sich derzeit nicht nur Notebooks, WLAN-Repeater und Laserdrucker besonders gut. ‚Auch Gefrierschränke und Kühlschränke werden überdurchschnittlich oft gekauft und auch Staubsauger sind derzeit sehr beliebt‘, heißt es von Mediamarkt/Saturn. Außerdem brumme es im Bereich Gaming.“ Wie viel von den Einnahmen der Vorkrisen- und auch noch der Krisengewinnler ist bei jenen angekommen, die sie mit den von ihnen geschaffenen Werten einfahren, bei den Arbeitern in den Betrieben, den Angestellten in den Büros und den Geschäften? Die Coronakrise bringt es an den Tag. Sie macht ein wenig transparent, was ansonsten eher geheim gehalten wird. Und sie verschweigt, was die Konzerne sehr genau vorhersehen: das Himmlische Jerusalem hinter der Apokalypse.
Was die Wirtschaft plagt, wiederholt sich in kleinerem Maßstab bei freischaffenden Autorinnen und Autoren. Es ergibt sich das Paradox, dass jene die größten Verluste durch die Coronakrise erleiden, die die höchsten Gewinne gemacht haben. Bekanntlich können die wenigsten Autoren von den Honoraren für ihre Bücher leben. Ins Gewicht fallen Lesungen, die sie mit etwas Glück absolvieren. Wer sich einen Agenten leisten kann, der für Starautoren erkleckliche Lesungshonorare aushandelt, wer nach dem Erscheinen eines Buchs von Ort zu Ort fährt und dabei recht gut verdient, hat jetzt, da die Lesungen wegen der Ansteckungsgefahr ausfallen, herbe Einbußen zu ertragen. Man redet nicht darüber, aber es sei hier verraten, dass es Autoren, auch Fernsehjournalisten gibt, die für eine Lesung – etwa vor Industriellen – mehrere Tausend Euro erhalten. Wer aber ohnedies wenig oder nichts zu erwarten hat, bleibt verschont. Ich gehöre einer Autorenvereinigung an, deren Mitglieder in ihrer großen Mehrheit an der Armutsgrenze leben. So sie in Kleinverlagen veröffentlichen, müssen sie schon zufrieden sein, wenn sie zwei, drei Lesungen im Jahr haben, die oft mit weit unter den von den Schriftstellerverbänden empfohlenen Honoraren entgolten werden. Ihr Coronatribut fällt kaum ins Gewicht. Sie haben schon zuvor wenig verdient. Das künstlerische Prekariat bleibt mit und ohne Virus Prekariat. Das gilt auch für nicht fest angestellte Schauspieler, Musiker, Performer. Anders als Deichmann und H&M können sie sich nicht einfach weigern, ihre Miete zu bezahlen. Angesichts dieses Zustands hält sich das Mitleid mit Großunternehmen, die staatliche Unterstützung fordern, in Grenzen.
|
Thomas Rothschild - 7. April 2020
2671
|
 Fast alles wie zuvor
Fast alles wie zuvor
|
Zu den dämlichsten Phrasen, derer sich Journalisten bedienen, die zur Sprache ein eher gestörtes als intimes Verhältnis haben, gehört das Mantra, es werde „nichts mehr so sein wie vorher“. Sie bringt fünf Kernelemente des schlechten Journalismus zusammen: das Pathos, die Übertreibung, die Vereinfachung, die Pauschalisierung, die vorgetäuschte Gewissheit. Und sie ist schlicht unzutreffend. Sie kursierte epidemieartig, als zwei Flugzeuge die New Yorker Twin Towers zum Einsturz brachten. Sie tauchte bei jeder kleineren Katastrophe wieder auf. Und sie feiert nun, anlässlich des Coronavirus, eine geradezu bombastische Renaissance.
Der Satz ist so offensichtlich falsch, dass man sich nur darüber wundern kann, wie hirnlos er in den Medien dahergeplaudert wird. Fast alles ist nach 9/11 so geblieben, wie es war, und fast alles wird nach Überwindung der Corona-Krise so bleiben wie zuvor: Die Naturgesetze sowieso – Wasser wird nach wie vor von oben nach unten und nicht von unten nach oben fließen, ein Körper wird im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung verharren, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, diesen Zustand zu verändern – und die sozialen Zustände auch. Die Menschen in den reichen Ländern werden weiterhin untätig zusehen oder vielmehr wegschauen, wenn täglich Kinder in der Dritten Welt massenweise verhungern, einige Wenige werden immer größere Reichtümer anhäufen, während sehr viel mehr mit einem Existenzminimum ihr Auslangen finden müssen, die Obdachlosen werden wie zuvor die überteuerten Mieten für eine Wohnung nicht bezahlen können, und der Staat wird wie zuvor weniger zögern, eine insolvente Bank zu unterstützen als ein insolventes Theater. Die Regale werden wieder gefüllt sein mit hinreichenden Mengen von Klopapier, das, wer sich mittlerweile das Sparen angewöhnt hat, auch beidseitig verwenden kann. Der Erfolg liegt auf der Hand. Der CO2-Ausstoß wird so hoch sein wie vorher, und die Gletscher werden weiter abschmelzen. Man wird weiterhin die gleichen unfähigen Politiker wählen und undemokratische Maßnahmen mit einem Schulterzucken hinnehmen oder sogar befürworten. George W. Bush hat einen auch für seine Heimat unheilvollen Krieg gegen den Irak begonnen. Er wurde trotzdem ein zweites Mal zum Präsidenten der USA gewählt. Alles wie vorher. Viktor Orbán hat seit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten im Jahr 2010 systematisch die Demokratie in Ungarn demontiert. Trotzdem wurde er 2014 erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Alles wie vorher. Journalisten, die gebetsmühlenartig versichert hatten, dass nichts mehr so sein werde wie vorher, versicherten weiterhin, dass nichts mehr so sein werde wie vorher, und widerlegten mit ihrer eigenen Persistenz ihre These. Sie waren wie vorher.
Ebenso unbestreitbar freilich wie das Faktum, dass nach dem New Yorker Attentat fast alles so geblieben ist wie vorher und dass das auch nach dem Datum „Corona“ so sein wird, ist die Tatsache, die in der Antike auf gut Altgriechisch auf „panta rhei“ verkürzt wurde: „alles fließt“. Mit anderen Worten: Veränderung findet ständig statt. Bertolt Brecht hat diese Gleichzeitigkeit von Veränderung und Beharrung so in Verse gebracht: „Von den Großen dieser Erde / melden uns die Heldenlieder: / Steigend auf so wie Gestirne / gehn sie wie Gestirne nieder. / Das klingt tröstlich, und man muss es wissen. / Nur: für uns, die sie ernähren müssen / ist das leider immer ziemlich gleich gewesen. / Aufstieg oder Fall: Wer trägt die Spesen?“
Das Einzige, was spektakuläre Ereignisse wie 9/11 oder eine Epidemie vom üblichen Ablauf der Geschichte unterscheidet, ist die Geschwindigkeit und damit die Sichtbarkeit von – kurzfristigen oder anhaltenden – Veränderungen. Die Industrialisierung etwa oder die Erfindung des Computers haben weitaus mehr verändert als islamistische Terroristen und das Coronavirus zusammen. Nach Henry Ford oder Bill Gates war sehr viel mehr „nicht mehr wie vorher“ als nach den Katastrophen unseres Jahrhunderts. Nur zeigte sich das nicht schlagartig, sondern erst allmählich. Kein Thema also für Zeitungsüberschriften. Die Leben vom Tag. Über einen größeren Zeitraum blicken sie oder vielmehr ihre Verfasser nicht hinaus. Das wird bis auf weiteres so bleiben. Wie zuvor.
Dass übrigens selbst die Quarantäne in punkto Vereinsamung heute nicht ist wie die Quarantäne zur Zeit der Spanischen Grippe, ist nicht eine Folge der Pandemie vor gut einem Jahrhundert, sondern der Erfindung von Fernsehen und Versandbuchhandel. Die Welt ist längst in die Wohnzimmer gedrungen. Allmählich. Und ganz ohne Katastrophe. Schon vor dem Coronavirus saß die Familie vor dem Bildschirm und schwieg. Das Familienleben fand in der Lindenstraße statt. Das wird auch nach der aktuellen Krise so sein. Auch wenn die Lindenstraße dann einen anderen Namen trägt.
|
Thomas Rothschild - 1. April 2020
2670
|
 Das vernehmliche Schweigen des PEN
Das vernehmliche Schweigen des PEN
|
Die Präsidentin des PEN Zentrums Deutschland Regula Venske hat ein Problem. Das Coronavirus hat es ihr eingebrockt. Sie stellt klar: „‚Soziale Distanz‘ klingt wie ein Begriff aus dem Wörterbuch des Neoliberalismus. Wir alle aber wissen, dass jetzt soziale Nähe gefragt ist: Kooperation, Verantwortung füreinander. Man mag sagen, dass es derzeit dringlichere Probleme gibt, als Worte auf die Goldwaage zu legen. Aber Sprache prägt unser Denken und unser Verhalten. Im Englischen bedeutet social heute vor allem ‚gesellig‘ und erst in zweiter Linie das, was wir im Deutschen unter sozial verstehen. Social distancing mag also angehen. Im Deutschen steht das Wort sozial allerdings vor allem für gesellschaftliche Werte wie Gemeinsinn und Solidarität. Jetzt sind physische Distanz bzw. körperlicher Abstand geboten, ‚soziale Distanz‘ hingegen, das macht die Corona-Krise deutlich, gerade nicht!“
Das kommt, wenn man sich in seinem sprachkritisch-moralistischen Eifer auf Wörterbücher verlässt. Das englische „social“ wird heute, im englischen wie im deutschen Sprachraum, vor allem in einem Zusammenhang verwendet, nämlich in der Kombination „Social Media“. Damit sind bekanntlich digitale Medien wie Facebook oder Twitter gemeint, und das Attribut bedeutet weder „gesellig“, noch „sozial“ im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Werten wie Gemeinsinn und Solidarität. Wenn man den missverständlichen Ausdruck „soziale Distanz“ oder „soziale Distanzierung“ ablehnt, so bietet sich im Deutschen das Beiwort „räumlich“ an. Der Vorschlag „körperlicher Abstand“ allerdings beweist nur, dass die PEN-Präsidentin ein innigeres Verhältnis zu Verboten als zur deutschen Sprache hat. Der Abstand zwischen Körpern ist ebenso wenig körperlich wie das Verhältnis des Denkens zur Sprache sprachlich ist.
Bedenklicher als solche Unschärfen der Sprache, des Denkens und des Verhaltens jedoch ist, dass der deutsche PEN vor lauter Aufgeregtheit über das Adjektiv „sozial“ seine Kernaufgaben vergisst. Sie stehen in der PEN-Charta. Da heißt es unter anderem: „Der PEN steht für den Grundsatz eines ungehinderten Gedankenaustauschs innerhalb einer jeden Nation und zwischen allen Nationen, und seine Mitglieder verpflichten sich, jeder Art der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in ihrem Lande, in der Gemeinschaft, in der sie leben, und wo immer möglich auch weltweit entgegenzutreten. Der PEN erklärt sich für die Freiheit der Presse und verwirft jede Form der Zensur.“
Übermorgen erscheinen im Rowohlt Verlag die Memoiren von Woody Allen. Wie seit zweieinhalb Wochen bekannt, haben eine Reihe von Autorinnen und Autoren des Verlags gegen die Veröffentlichung dieses Buchs protestiert. Der deutsche PEN hat vernehmlich zu diesem Ansinnen geschwiegen. Er hat nichts dagegen vorzubringen, dass ein intellektueller Lynch-Mob das freie Wort verhindern möchte und Zensur fordert. Der Hinweis, Woody Allen könne ja anderswo publizieren, kann nur als zynisch bewertet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die gegen Woody Allen vorgebrachten Vorwürfe weder bewiesen, noch gar von einem Gericht, das im Gegensatz zu Rowohlt-Autoren für Verstöße gegen Gesetze zuständig wäre, bestätigt wurden. Selbst wenn das nämlich der Fall wäre, hätte die PEN-Charta Gültigkeit. Darin steht nichts davon, dass sie durch Vergehen welcher Art auch immer außer Kraft gesetzt würde. Auch ein Jean Genet steht unter ihrem Schutz.
Das Schweigen des deutschen PEN zur Zensurforderung von Kolleginnen und Kollegen Woody Allens, die von ihm vor allem unterscheidet, dass sie nicht so gut schreiben wie er, macht die Forderung von Gemeinsinn und Solidarität unglaubwürdig. Sie kommt, wie sich erweist, von Sittenwächtern, die in ihrer Polizei- und Zuchtmeistermentalität selbst dort Vergehen ahnden, wo kein Vergehen erwiesen ist. Dafür eignet sich weder das Beiwort „sozial“, noch „physisch“, noch „körperlich“. Vielleicht käme „niederträchtig“ in Frage.
|
Thomas Rothschild – 26. März 2020
2668
|
 Die Zwickmühle
Die Zwickmühle
|
Angesichts der immer bedrohlicheren Vorstöße der Rechten, angesichts ihres immer dreisteren Hohns über demokratische und emanzipatorische Werte, möchte man jenen, die ihnen in der Gesellschaft im allgemeinen und in der Kultur im besonderen Widerstand leisten, die Sympathie und die Unterstützung nicht versagen. Um keinen Preis will man ihnen in den Rücken fallen. Das Geschäft der Kritik freilich gerät dabei in eine Zwickmühle. Nicht alles, was von einer ehrenwerten Gesinnung zeugt, ist auch künstlerisch lobenswert. Manchmal steht gerade die förderungswürdige Absicht der künstlerischen Umsetzung im Wege. Der verschiedenen Autoren zugeschriebene Satz, dass das Gegenteil von gut gut gemeint sei, hat, wenn man ihn von seiner Apodiktik befreit, seine Gültigkeit bewahrt.
Wenn im doppelten Wortsinn anständige Kritiker jedoch das gut Gemeinte preisen, weil sie, wie erwähnt, deren Urheber nicht in den Rücken fallen wollen, haben die Rechten schon gesiegt. Denn sie haben jenen, die sie bekämpfen – und in diesem Relativsatz ist das Pronomen „sie“ sowohl als Subjekt, wie auch als Objekt zu verstehen –, ihre Maßstäbe aufgezwungen, sie an der Wahrheit gehindert.
Die Attacken von rechts haben, so scheint es, die Ideologisierung der Kulturdebatten forciert. Nicht zu ihrem Vorteil. Kürzlich wurde, vom Deutschlandfunk übertragen, über Margaret Mitchells Vom Winde verweht in einer Neuübersetzung diskutiert. Dabei ging es unter anderem darum, ob dieser Roman bislang unterschätzt worden sei. Für oder gegen seine Qualität brachten die Gesprächspartner vor, dass er das Wort „Neger“ verwendet oder ein kritisches Bild vom Krieg zeichnet. Das sind Beobachtungen, die unter literatursoziologischem oder ideengeschichtlichem Aspekt von Interesse sein können. Über die literarische Qualität sagen sie nichts aus.
Die Verteidigung aber von künstlerischem Anspruch, von artistischer Souveränität ist nicht weniger eine aufklärerische Position als die Abwehr von Angriffen auf die menschliche Würde. Wer sich auf die Indienstnahme der Künste, für welche Ideale auch immer, einlässt, hat bereits die Bedingungen der Rechten akzeptiert. Das mag nicht immer so gewesen sein. In Zeiten der zugespitzten politischen Gegensätze haben es auch linke Dichter*innen, Maler*innen, Komponist*innen, Theatermacher*innen für richtig gehalten, sich im Kampf für die angestrebten Ziele künstlerischer Mittel zu bedienen, und es waren nicht die schlechtesten. Heute aber sind es unübersehbar die Rechten außerhalb und zunehmend in den Parlamenten, die eine Funktionalisierung der Kultur für ihre Zwecke voranzutreiben bestrebt sind. Wollen wir uns darauf einlassen? Wollen wir nach den Regeln der AfD und ihrer Anhänger spielen? Oder wollen wir ihnen die Meinungsdominanz verweigern und auf einer Kunst bestehen, die diesen Namen verdient? Wir werden uns entscheiden müssen.
|
Thomas Rothschild - 8. März 2020
2662
|
 Manipulierte Wahrheit
Manipulierte Wahrheit
|
Als Hermann Gremliza kürzlich starb, bescheinigten ihm Nachrufschreiber, die ihn zu Lebzeiten geflissentlich übersehen hatten – welche Talkshow, die jeden Trottel für intellektuell satisfaktionsfähig hält, hat ihn zuletzt eingeladen? –, dass er als einer der brillantesten Stilisten im deutschen Journalismus zu gelten habe. Für seine Argumente fiel ihnen nicht viel mehr ein, als dass er ein „Vereinfacher“ gewesen sei. Belege blieben sie schuldig. Auf Inhalte wollten sie sich gar nicht erst einlassen.
Die gleiche Doppelstrategie leistete auch ihre Dienste, als Peter Handke der Literaturnobelpreis zugesprochen wurde. Selbst die Verteidiger des Schriftstellers zogen sich auf den Standpunkt zurück, dass Handke als Literat ausgezeichnet werde und seine politischen Äußerungen nichts damit zu tun hätten. Dass diese verwerflich seien, galt als ausgemacht. Die verordnete Einheitsmeinung zur Zerschlagung Jugoslawiens durfte nicht hinterfragt werden.
Jetzt hat es Daniela Dahn gewagt, sich diesem Konformismus entgegen zu stellen, und es lässt sich ahnen, dass sie dafür Prügel beziehen wird. Eins aber darf man verlangen: dass niemand, der als halbwegs redlich gelten will, Handke künftighin moralisch attackieren darf, der die von Daniela Dahn aufgelisteten Fakten nicht widerlegen kann. Sie sind auf ossietzky.net nachlesbar. Für Unkenntnis gibt es ab sofort keine Entschuldigung.
|
Thomas Rothschild - 9. Januar 2020
2654
|
 Gattungsbewusstsein
Gattungsbewusstsein
|
Ein paar lautstarke Expertendarsteller, die zur Literatur ein ähnliches Verhältnis haben wie der Metzger zur Sau, rufen unentwegt nach dem Roman, der die bedeutsamen historischen Daten des vergangenen Jahrhunderts, den Holocaust etwa oder die deutsche Wiedervereinigung, zum Thema wählt. Sie beweisen damit nur, dass sie nicht begriffen haben, was der Roman zu leisten vermag und vom Don Quixote bis zum Proceß, vom Tristram Shandy bis zum Ulysses, von Anna Karenina bis zu Hundert Jahre Einsamkeit geleistet hat, und wo der Gattung Grenzen gesetzt sind. Für die künstlerische Verarbeitung von Geschichte eignet sich keine andere Gattung so vorzüglich wie der Dokumentarfilm, und vom Roman zu verlangen, was dieser weitaus überzeugender zu erbringen vermag, gleicht dem Ansinnen, von einer Sonate ein Bild der Mona Lisa zu fordern.
Den Künstlern und ihren Kritikern ist das Bewusstsein von den Spezifika der Gattungen und Genres, von ihren Möglichkeiten und Grenzen abhanden gekommen. Sie denken nur mehr in Inhalten, nicht in künstlerischen Formen. Sie wollen, egal mit welchen Mitteln, aussprechen, was gerade „gefragt“, was gerade „angesagt“ ist oder was sie aus ihrer engen Erfahrung kennen, und das ist vor allem das Fernsehen und die Popmusik. Und so gleichen sich die Orte der verschiedenen Sparten immer mehr einander an. Die Großveranstaltungen der Bildenden Kunst, des Films, des Theaters bieten die gleichen Installationen, Performances und Events an. Jeder Roman, jeder Film steht für eine Bühnenbearbeitung zur Disposition, und kein Theaterstück ist immun gegen die Hits der siebziger Jahre.
Wie aus einer anderen Welt müssen heute ein Tschechow oder ein Schnitzler erscheinen, die wussten, welcher Stoff sich für eine Kurzgeschichte und welcher sich für ein Drama eignet. Exotisch wirkt in diesem Umfeld ein Alexander Kluge, der sehr genau unterscheiden kann, wann er einen Film dreht, wann er für das Fernsehen produziert, wann er ein Buch schreibt.
E.T.A. Hoffmann war ein beachtlicher Komponist. Dass er aus den Lebens-Ansichten des Katers Murr einen Roman gemacht hat und nicht eine Oper, muss wohl seine Gründe haben.
|
Thomas Rothschild - 11. September 2019
2639
|
 Schamlosigkeit
Schamlosigkeit
|
Wer eine Rezension liest, geht davon aus, dass der Rezensent zwar seine eigenen Maßstäbe hat und sich auch irren kann, dass er aber in seinem Urteil frei ist von Rücksichtnahmen, dass ihn also keine persönlichen Verflechtungen an den Autor und sein Werk binden. Das war auch lange so. Ein Redakteur, der seinen guten Ruf bewahren wollte, hätte nicht zugelassen, dass jemand ein Buch oder auch eine Theateraufführung, ein Kunstwerk von jemandem bespricht, zu dem er in einem Abhängigkeitsverhältnis welcher Art auch immer steht.
Das hat sich geändert. Ohne Bedenken loben und preisen Rezensenten – es können auch Rezensentinnen sein – die Bücher von Autoren – es können auch Autorinnen sein –, mit denen sie zuvor eng zusammengearbeitet hatten. In der Wissenschaftspublizistik lassen sich Huldigungen von Rezensenten für Autoren nennen, die zuvor ihre Dissertation oder Habilitation betreut und ihre Karriere befördert hatten. Die Schamlosigkeit kennt keine Grenzen. Früher, als die heute in Mode gekommene Formel „Das geht aber gar nicht“ (mit Betonung auf „gar“) noch nicht gebräuchlich war, hätte man gesagt: „Das ist unanständig. Das gehört sich nicht. Das tut man nicht. Das ist, wie wenn man in Gesellschaft rülpst oder wie wenn man Kinder schlägt.“
Der rezensorische Sittenverfall greift um sich. Statt von „Gefälligkeitsjournalismus“ spricht man von „Netzwerk“, und das rechtfertigt für jene, die dazu gehören, jeden Freundschaftsdienst. Die Schweinerei ist eine zweifache: einmal von Seiten der Person, die sich derart für empfangene Protektion bedankt, und dann vor Seiten der Person, die diesen Dank zulässt, vielleicht sogar erbeten hat. Diese Praxis nach dem Prinzip des „do ut des“ ist Betrug von der gleichen Qualität wie das Plagiat. Der Gelackmeierte ist der Leser. Er sollte sich bei Besprechungen nach dem Rezensenten und dem Rezensierten erkundigen. Das brächte so mancherlei ans Licht. Ein Indikator für die Redlichkeit von Rezensionen ist die Anzahl von unabhängigen Rezensenten, die ein Buch für besprechenswert halten und zum gleichen begeisterten Ergebnis kommen wie die Rezensenten aus dem Umfeld des Rezensierten. Wenn sie ausbleiben, darf man vermuten: da ist Kungelei im Spiel.
|
Thomas Rothschild - 16. Juli 2019
2630
|
 Morgen Augsburg
Morgen Augsburg
|
Armin Petras ist als Theaterleiter in Stuttgart gescheitert. Nicht, weil er schlechtes Theater macht, sondern weil sein Theater nicht zu Stuttgart passt. Kay Voges wäre gern an die Volksbühne nach Berlin gegangen. Hat nicht geklappt. Jetzt geht er ans Volkstheater nach Wien. Die beiden Bühnen haben nicht mehr als die Silbe „Volks“ gemeinsam. Hat Voges für Wien ein anderes Konzept als er für Berlin gehabt hätte? Das Volkstheater hat er nach eigener Aussage ein einziges Mal besucht. Ist er bei Nestroy und Werner Schwab genau so daheim wie bei Kleist und Heiner Müller? Wenn nicht – was lässt sich daraus schließen? Karlheinz Braun in einem Gespräch mit nachtkritik.de: „Ich würde mir wünschen, dass die Theater wieder mit festen Hausregisseuren, festen Ensembles eine eigenständige, originale Leistung erbringen und nicht verwechselbar werden mit ihren Spielplänen und Produktionen. Dass man wieder sagen kann: Das ist eine sehr spezifische Theaterarbeit, die man nur in Bremen, Frankfurt oder Ulm sehen kann.“
|
Thomas Rothschild - 10. Juni 2019 (2)
2625
|
 Märchenstunde
Märchenstunde
|
So, liebe Kinderchen, jetzt erzählt euch Großmutter Thomas ein Märchen. In grauer Vorzeit gab es ein Theater, da liefen Römer in einer wallenden weißen Toga herum, wenn Julius Cäsar gespielt wurde, und Hamlet trug einen kurzen Rock und enge Beinkleider. Man nannte das Kostümtheater, und die Aufführungen verstaubten allmählich. Inzwischen verstauben die Kostüme im Fundus, und ihr, meine lieben Kinderchen, habt kaum noch eine Vorstellung davon, was Kostümtheater war. Denn heute flanieren die Römer in Blue Jeans über den Broadway und Hamlet begibt sich in die Direktion der Deutschen Bahn, wo etwas, wie es im Text heißt, faul ist. Das Theater ist in einer Zeit angekommen, deren gelegentliche Ähnlichkeit mit der Gegenwart darüber hinwegtäuscht, dass sie nirgends angesiedelt ist. Denn wenn man die Zeit, in der ein Stück entstanden ist und in der es spielt, wegretuschiert, dann entsorgt man die Geschichte. Hinter diesem allgegenwärtigen Geschichtsverlust, der das eigentliche Ärgernis im heutigen Theater darstellt, steckt die reaktionäre Ideologie, dass immer alles gleich bleibt. Wer sie akzeptiert, muss gegen einen schlechten Status quo nicht rebellieren. Es kommt eh nichts Besseres nach. Es war immer schon so und wird immer so bleiben.
|
Thomas Rothschild - 7. Juni 2019
2624
|
|
|
Anzeige:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
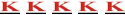
= nicht zu toppen
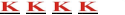
= schon gut
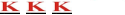
= geht so

= na ja

= katastrophal
|