|
Hiergebliebene
|

|
Bewertung: 
Sie hatten keinen guten Ruf: die Dichter und Dichterinnen, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die in der Zeit des Nationalsozialismus im Lande blieben. Für viele "draußen" waren sie Nazis, Sympathisanten, zumindest Feiglinge. "Drinnen" drohte Schreibverbot oder Schlimmeres. Nachträglich diskreditierte sie das berühmte Diktum Thomas Manns, Bücher, die zwischen 1933 und 1945 geschriebenen wurden, sollten eigentlich „eingestampft“ werden. Der (rehabilitierende) Begriff der „inneren Emigration“ wurde erst 1945 geprägt.
Dabei verließ Thomas Mann Deutschland vor allem auf Druck seiner Kinder, er war bekannt und vermögend genug. Andere, weniger erfolgreiche Autoren sahen keine Chance auf eine neue Existenz. Warum aber blieb beispielsweise ein Hans Fallada? Sein Erfolgsroman Kleiner Mann, was nun? aus dem Jahre 1932 war ins Englische übersetzt. Er hätte problemlos nach Amerika auswandern können, Hollywood rief. Doch der labile und gesundheitlich angeschlagene Schriftsteller traute sich die Emigration nicht zu. Nachdem er schon 1933 für kurze Zeit verhaftet worden war, zog er sich aufs Land zurück. Wie so viele stellte er sein Talent den Nazis zur Verfügung, lavierte, knickte ein, wenn seine Texte kritisiert wurden - und schrieb um. Nur ein Jahr nach dem Krieg, also schon 1946, erschien allerdings sein vielbeachteter Roman Jeder stirbt für sich allein, in dem er sich als erster mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzte.
Ein Versuch, den auch Erich Kästner unternahm, aber nicht vollenden konnte. Auch er verließ Deutschland nicht, obwohl er zusehen musste, wie 1933 seine Bücher verbrannt wurden. Doch es gelang ihm, mit seinen Kinderbüchern und relativ unverfänglichen Gedichten aus der „lyrischen Hausapotheke“ zu überleben. Andere hatte weniger Glück.
Jakob Wassermann, einer der beliebtesten Erzähler, wurde krank und starb nach wenigen Jahren. Sofort nach der Machtergreifung war er aus der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen worden – wegen jüdischer Herkunft. Dabei wollte ausgerechnet er so gern ein Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft sein!
Rudolf Binding, ein damals geschätzter Lyriker, empörte sich zwar über den Rauswurf von Juden und Linken aus der Akademie, lobte aber, dass die Bewegung dem deutschen Volk nach den Versailler Verträgen wieder den Glauben an sich selbst gegeben habe. Er starb 1938, leidend am Regime, aber bis zuletzt um persönliche Integrität bemüht.
Kann man das auch von Gottfried Benn behaupten? Er, einer der großen deutschen Dichter und eine schillernde Figur, spielte eine höchst ambivalente Rolle. Als Arzt verteidigte er sogar die Schaffung von „Erbgesundheitsämtern“. Nach dem Krieg war er sofort wieder da und wurde hoch geehrt: mit dem Büchner-Preis und dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.
Wie weit ging die Anpassung vieler deutscher Intellektueller? Wer konnte da- und „sauber“ bleiben? Wie hätte man es überhaupt „richtig“ machen können, wo schon der Kontakt zu einem Exil-Verlag gefährlich war?
*
Anatol Regnier hat für dieses Buch unglaublich viele Nachlässe bekannter und unbekannter Autoren und Autorinnen gesichtet und jahrelang akribisch recherchiert. Der Nationalsozialismus ist sein Lebensthema. Er sieht ihn aus dem kritischen Abstand eines Nachgeborenen – aber auch mit viel Empathie für die Not seiner Elterngeneration. Schließlich ist er der Sohn des Schauspielerpaares Charles Regnier und Pamela Wedekind, die beide durchaus erfolgreich unter den Nazis arbeiten konnten.
So entsteht ein außerordentlich spannendes, hervorragend geschriebenes und vor allem höchst differenziertes Bild einer Epoche, die vielen Schriftstellern mehr Mut und Klarsicht abverlangte, als sie hatten. Auch ein Künstler ist nur ein Mensch, resümiert Regnier.
So gibt er selbst zu: er wagte es nicht, zu seiner deutschen Herkunft zu stehen, als er in jungen Jahren Glück und Erfolg in Israel fand. Er duckte sich weg, log und erfand eine Schweizer Abstammung, war „also genauso feige wie meine Landsleute … genauer gesagt: noch feiger. Denn was hätte mir in Israel passieren können? Ganz und gar nichts.“
Petra Herrmann - 23. Januar 2021
ID 12705
Verlagslink zu
Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus
Post an Petra Herrmann
petra-herrmann-kunst.de
Buchkritiken
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

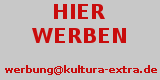
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
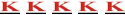
= nicht zu toppen
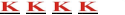
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|