|
Akademisch
seziert
|

|
Bewertung: 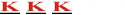
Es gibt wohl unzählige Bücher über Pablo Picasso. Der Ausnahmekünstler galt schon zu Lebzeiten als Genie, seine im Millionenbereich gehandelten Bilder füllen die Museen der Welt, und kaum ein Kunstinteressierter wird den begnadeten Maler nicht kennen.
Picasso wusste um sein Talent, er hatte Ausstrahlung, und er wirkte auf Frauen. Sein Künstlerleben lang umgab er sich mit schönen Gefährtinnen. Zwei seiner Musen heiratete er, mit anderen verbrachte er Jahre seines Lebens, in denen er ihnen viel abverlangte. Ein Leben mit Picasso war nicht einfach, doch welche Demütigungen und Leiden für die Partnerinnen, mit denen er fast immer eng zusammenlebte, einhergingen, macht das Buch von Rose-Maria Gropp deutlich.
Bei Picasso gab es keine Trennungen. Wenn seine Liebe erloschen war, betrat eine neue Frau das Atelier, stand Modell und wurde Geliebte. Ihre Vorgängerin konnte daraus nur ihre Konsequenzen ziehen.
Die Frauen wollten als Vorlage für seine Bilder unsterblich werden, und tatsächlich zieren ihre Portraits, aber auch andere künstlerische Umsetzung der jeweiligen Person, die Museen. Was diese Bilder zeigen, spiegelt die in diesem Moment empfundenen Gefühle von Picasso für seine Geliebte wider. Für die Autorin sind sie Maß für seine Leidenschaft. Sorgfältig seziert sie die jeweiligen Bilder, dazu Quellen über die gemalten Frauen und zieht ihre Analysen. Das wirkt überzeugend, aber auch sehr trocken. Die Emotionen, von denen hier die Rede ist, erstarren in den Texten von Gropp.
"Man könnte sagen, der Umstand, dass Picasso die magische Anverwandlung von Welt durch seine Malerei an Frauen exerzierte, fiel in eins mit dem Versuch, ihrer Herr zu werden. Das macht die Demoiselles (d´avignon) nicht zum simplen Beleg für eine generelle Misogynie ihres Schöpfers, aber sie tragen dieses Potenzial in sich. Es wird seine Fortführung in Variationen dort finden, wo Picasso immer wieder aus der zunächst angebeteten Schönheit einer Frau eine Grimasse oder gar Furie machen wird, wenn es zu Problemen mit ihr gekommen ist, bis hin zur Serie der Femme qui pleure gegen Ende der Dreißigerjahre." (Göttinnen und Fußabstreifer, S. 64)
Die Bilder von Picasso werden in verschiedene Perioden eingeteilt, und Rose-Maria Gropp bewegt sich mit großer Sicherheit in seinem Werk. Für mich hagelt es zu viele Fachbegriffe und Fremdworte. Der Laie, der sich schlicht und einfach an den Bildern von Picasso erfreut möchte, vielleicht einfach etwas über den Menschen und sein Verhältnis zu den Frauen erfahren, da wäre manchmal weniger mehr.
Deutlich wird, dass Picasso im Umgang mit seinen Frauen gewisse Brutalitäten zeigte, sie so nachhaltig beeinflusste, einengte und auf seine Bedürfnisse zu reduzieren versuchte, dass zwei Frauen nach der Liaison Selbstmord verübten, andere in psychiatrische Behandlung mussten. Allerdings wurde keine der Frauen gezwungen, mit ihm zu Leben. Es war der Preis, den sie zahlten in seinem Universum sein zu dürfen. Einzig Sylvette David, die Frau mit dem Pferdeschwanz, wurde nie seine Geliebte. Auch wenn sie ihm zigmal Modell stand, gab es keine Amorösitäten zwischen den beiden. Das Bild, das er ihr schenkte, finanzierte ihr durch seinen Verkauf ein Haus. Sie hegt keinen Groll gegenüber dem Künstler, die Distanz blieb hier erhalten.
Interessant ist die letzte Frau im Leben von Picasso, Jacqueline Roque. Sie verblieb bis zum Ende seines Lebens als Ehefrau an seiner Seite. Gerade diese Beziehung erscheint mir in ihrer Schilderung besonders bizarr. Jacqueline war devot in einem fast unvorstellbaren Ausmaß. So nannte sie ihn auch in der Öffentlichkeit Monseigneur (zu deutsch am besten als "Eminenz" übersetzt) und bediente Picasso geradezu wie eine Sklavin. Doch zahlte Picasso für diese Art von Vergötterung seinen Preis. Der notorisch eifersüchtigen Ehefrau gelang es nahezu sämtliche Kontakte aus seinem Leben zu verbannen. Selbst seine Kinder und seinen Enkel würde Picasso nicht mehr wiedersehen, sie durften nicht einmal zu seiner Beerdigung kommen. Dass Picasso diese Trennungen akzeptierte, ist erstaunlich, da er seine Kinder liebte. Hier drängt sich mir eine Parallele zu zwei anderen starken Männern auf. So erlosch der Kontakt von Helmut Kohl nach seiner Heirat mit Maike Kohl-Richter zu seinen Söhnen. Ruth Seebacher-Brand ließ nicht einmal Michael Gorbatschow als Besucher zum todkranken Willi Brand vor, die Mutter seiner Kinder Ruth Brand durfte nicht zu seiner Beerdigung kommen. Vielleicht können Psychologen dieses Phänomen klären, der Autorin fällt es kaum als Besonderheit auf.
So bleibt ein interessantes Buch, das sich eher intellektuell dem Phänomen Picasso und den Frauen widmet, sauber recherchiert, aber in weiten Teilen blutleer.
Ellen Norten - 23. März 2023
ID 14114
Piper-Link zu
Göttinnen und Fußabstreifer
Post an Dr. Ellen Norten
Buchkritiken
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

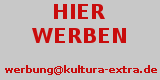
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
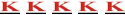
= nicht zu toppen
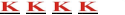
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|