|
Lob des
Misstrauens
|

|
Bewertung: 
Angesichts zunehmender Verschwörungstheorien von rechts häufen sich die Publikationen, die diese pauschal zu widerlegen versuchen. Analog aber zu dem Aphorismus „Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind“ ließe sich formulieren: „Nur weil Verschwörungstheorien abwegig sein können, heißt das nicht, dass es keine Verschwörungen gibt.“ Träfe das nicht zu, wäre es kaum zu erklären, warum sich die Staaten – mit Zustimmung derer, die Verschwörungstheorien für Auswüchse der Fantasie halten – Nachrichtendienste leisten und mit ansehnlichen Budgets ausstatten. Das ist das eigentlich Ärgerliche an rechten Kampfbegriffen wie beispielsweise Lügenpresse: dass sie es redlichen Kritikern fast unmöglich machen, sie dort zu gebrauchen, wo sie ihre Berechtigung haben, und den Verteidigern von Missständen erlauben, jeden der Begünstigung der Rechten zu bezichtigen, der sie, wenn auch mit anderen Gründen, verwendet.
Voraussetzung für Verschwörungstheorien ist das Misstrauen. Es hat, wie jene, eine schlechte Presse. In seinem Essay Misstrauen. Vom Wert eines Unwertes schickt sich Florian Mühlfried an, den diskreditierten Begriff zu rehabilitieren, ihn ins Positive zu kehren. Dabei implementiert der Autor, seinen biographischen Erfahrungen entsprechend, eine nicht unbedingt erwartbare „ethnologische Perspektive“„Es geht nun nicht mehr primär um die Geschäfte der Banken, das Spähen der Geheimdienste oder die Manipulationen der Automobilindustrie, sondern um deren Rezeption.“ Dem stellt Mühlfried die Behauptung gegenüber: „Nicht nur ohne Vertrauen, auch ohne Misstrauen kann Demokratie nicht bestehen.“ Er erkennt die „zahlreichen Warnungen vor Misstrauen als Teil einer politischen Agenda […], die auf die Restaurierung politischer Autorität abzielt“.
Konzise stellt Mühlfried dar, welchen Stellenwert Misstrauen in der liberalen, der demokratischen und der revolutionären Tradition hatte. In historischen und aktuellen Fallbeispielen – etwa zum Thema „Gastfreundschaft“ – demonstriert er die widersprüchliche Funktion und Wirkungsweise von Misstrauen. Leitmotivisch kehrt dabei die Überlegung wieder, dass Misstrauen nicht offen ausgesprochen, sondern tabuisiert, verheimlicht oder verdrängt wird.
Mühlfrieds schmales Bändchen gewährt eine anregende Lektüre, die trotz Verweisen auf die einschlägige Literatur von Durkheim und Freud bis Foucault und Luhmann keine Hürden der Methode und des Jargons in den Weg stellt. Und wenn man seinen Thesen mit Misstrauen begegnete, wäre da nicht das schlechteste Ergebnis.
Thomas Rothschild – 23. September 2019
ID 11695
Link zum Verlag
https://www.reclam.de/
Post an Dr. Thomas Rothschild
Buchkritiken
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

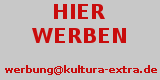
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
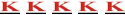
= nicht zu toppen
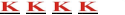
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|