|
Richard Strauss
und die anderen
|

|
Bewertung: 
Eigentlich ist Oswald Panagl Linguist. Aber seine Leidenschaft gehört der Musik, und so hat er kontinuierlich neben seinem Beruf als Universitätsprofessor in Zeitungen, namentlich den Salzburger Nachrichten in der Stadt, in der er seit 1979 gelehrt hat, in Programmheften und anderen einschlägigen Publikationsorten Aufsätze zum Musiktheater veröffentlicht, von denen jetzt eine Auswahl in einem umfangreichen Band unter dem Titel Im Zeichen der Moderne. Musiktheater zwischen Fin de Siècle und Avantgarde vorliegt. Wie so oft, liefert der Untertitel die genauere Information über den Inhalt. Denn ob man etwa Puccini oder Eduard Künneke zur Moderne rechnen darf, ist zumindest fragwürdig. Der Autor freilich gibt sich redlich Mühe, diese Wortwahl zu begründen. Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass der Begriff „Moderne“, ähnlich wie „Romantik“ oder „Ballade“, in konkurrierenden Bedeutungen im Umlauf ist.
Das Spektrum der Beiträge reicht von Richard Strauss, dem seit langem ein besonderes Interesse des Autors zukommt und dem er immerhin ein Viertel des Bandes widmet, was wohl auch mit dem Rang oder vielmehr dem Ansehen der Libretti zu tun hat, bis Benjamin Britten, von Hans Pfitzner bis Kurt Weill, von Leoš Janáček bis Alexander Zemlinsky, von Carl Nielsen bis zu dessen Altersgenossen Ferruccio Busoni. Schade, dass die Kapitel zu Rimski-Korsakows selten gespielter Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch und zu Karol Szymanowskis außerhalb Polens ebenso unterschätztem König Roger unverhältnismäßig kurz geraten sind. Und auch zu Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk, die es, mit Verlaub, mit einigen der abgehandelten deutschen Opern aufnehmen kann, hätte man sich mehr Ausführlichkeit gewünscht. Bei der Aufzählung von Inszenierungen des Spielers von Prokofjew vermisst man Andrea Breths geniale Umsetzung in Amsterdam im Jahr 2013. Dass sich die abschließenden Gedanken zur amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts im wesentlichen auf Gershwin, Bernstein und Adams beschränken, ist, gerade mit Blick auf das Musiktheater, eher bedenklich. Selbst wenn Panagl die Pendants zu Eduard Künneke, unter dem Label „Moderne“, außer Acht lassen durfte, hätten Gian Carlo Menotti oder Phil Glass mehr als nur eine Namensnennung verdient. Was die Zwänge des ursprünglichen Publikationszusammenhangs noch verständlich erscheinen lassen, stört im Sammelband die Proportionen.
Panagl argumentiert mit Text und Dramaturgie, nicht mit der Partitur. Die Werkanalyse füllt er auf mit biographischen und historischen Details. Dass er sich nicht um Pfitzners kritikwürdige Haltung im Dritten Reich drückt, spricht für seine bei aller Bewunderung unbestechliche Haltung. Nur ausnahmsweise schiebt er einen Absatz zur Aufführungsgeschichte ein. Das liest sich unangestrengt und hat den Vorzug, die Unschärfen musikwissenschaftlicher Terminologien und Beschreibungen zu vermeiden. In der Sorgfalt bei der Wortwahl und definitorischer, auch etymologischer Präzisierungen verrät sich der Sprachhistoriker. Manchmal kommt das ein wenig lehrerhaft daher, aber unter uns: ich habe nie verstanden, warum dieses Adverb einen negativen Beigeschmack hat. Ist es die Selbstüberschätzung der Ahnungslosen, die sich dagegen wehrt, belehrt zu werden?
Thomas Rothschild – 21. Dezember 2020
ID 12665
Hollitzer-Link zum Sachbuch von
Oswald Panagl
Post an Dr. Thomas Rothschild
Bücher
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

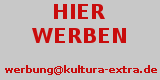
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
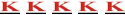
= nicht zu toppen
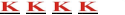
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|