|
Die Konstruktion
des Feindes
|

|
Bewertung: 
Soll man den Autor bewundern oder die akademischen Betreuer bedauern, die eine Dissertation von mehr als 800 klein bedruckten, allerdings oft zur Hälfe mit Fußnoten gefüllten Seiten begutachten mussten? Es geht darin um die Feindbilder im amerikanischen Spielfilm in der Zeitspanne von nur 25 Jahren, nämlich von 1980 bis 2005. Stefan Butter gab ihr den ebenso griffigen wie uneleganten Titel Die USA und ihre Bösen. Wer nun an Donald Trump denkt, wird durch den Untertitel sogleich ermahnt. Es geht eben um Feindbilder im amerikanischen Spielfilm 1980-2005.
Die Arbeit setzt ein mit der Situation, die durch die gewählte Periode vorgegeben ist: mit der „letzten Hochphase des Kalten Krieges“. Die Bösen sind, wie nicht schwer zu erraten, die Sowjets. Butter beschreibt und analysiert einzelne Filme, in denen dies besonders deutlich zutage tritt. Zu den Stärken der Dissertation gehört, dass sie mit der genauen Untersuchung der Filme zugleich ein Bild der nordamerikanischen Kultur- und Politikgeschichte liefert. Gerade in der dem Märchen abgeschauten vereinfachenden Konfrontation von Gut und Böse spiegeln sich ja, propagandistisch umgestaltet, die vorherrschenden gesellschaftlichen Normen. Butter führt aber auch eine Reihe von Filmen auf, die solchen Vereinfachungen widersprachen und „sich nicht dem neuen Konsens anschlossen, die vielmehr die amerikanische Politik kritisierten und zum Teil sogar für echte Völkerverständigung plädierten“.
Nach dem (vorläufigen?) Ende des Ost-West-Konflikts füllen bald „die Terroristen“, die „Schurkenstaaten“ die Leerstelle, die die Russen als favorisierter Feind, als Urbild alles Bösen hinterlassen habe. Aber auch außerirdische Angreifer, die „Aliens“, und in einzelnen historischen Rückgriffen die Nazis, eindeutig oder in „Verkleidung“, konnten diese Rolle übernehmen. Eine Spielart, die bei uns wohl weniger beachtet wurde, ist die Dämonisierung der Serben durch Analogisierung mit den Nazis.
Ein anderer Ersatz für das abhanden gekommene Feindbild der Sowjetunion ist die „gelbe Gefahr“. Hier wird die doppelte Sicht von Butters Arbeit besonders auffällig. Sie betrachtet den amerikanischen Film aus der Perspektive der amerikanischen Politik und Ideologie und zugleich die amerikanische Politik und Ideologie aus der Perspektive des amerikanischen Films. So hat der Vietnamkrieg die Voraussetzungen geschaffen für das vorherrschende (Feind)Bild der Vietnamesen im Film und dieses Bild wiederum Einstellungen von Amerikanern im Kriegseinsatz und daheim geprägt. Butter: „Die Vietnamfilme trugen so auch dazu bei, jene rassistischen Stereotype am Leben zu erhalten, die schon den Krieg selbst mitbestimmt hatten.“ Dieser Fokus auf die Wechselbeziehung zwischen Realpolitik und dem Medium Film hat allerdings zur Folge, dass Stefan Butter einen für narrative Strukturen bedeutsamen Gesichtspunkt vernachlässigt: die Produktivität von scharfen Gegensätzen, von Schön und Hässlich, von Tugend und Verbrechen oder eben von Gut und Böse. Zu fragen wäre: was unterscheidet den Russen, den Chinesen, den Islamisten im amerikanischen Film von Frankensteins Monster oder von Scarface? Sind die Bösen von heute nur späte Verwandte von Dr. Caligari (und somit keineswegs ein amerikanisches Spezifikum)?
In eine andere Richtung als die rassistische weist das Kapitel über den Drogenhändler als Feindbild. Die Propaganda gegen den Terrorismus oder was die politischen Vordenker als solchen definieren führt unausweichlich zur Verteufelung des Islam und der islamischen Welt. Mehrfach weist Butter darauf hin, dass diese Entwicklung nicht, wie es den Anschein haben mag, erst mit dem 11. September 2001, sondern schon viel früher eingesetzt hat. Die Logik einer Ursache-Wirkung-Beziehung, die als scheinbare Rechtfertigung dienen könnte, wird somit außer Kraft gesetzt.
Der Wälzer enthält eine beeindruckende List von Filmtiteln, von denen die meisten dem Leser unbekannt sein dürften, und eine noch beeindruckendere Liste der Sekundärliteratur. Es ist eben eine Dissertation. Zugleich aber wohl für einige Zeit das Standardwerk zum Thema.
Thomas Rothschild – 7. Februar 2020
ID 11984
Link zum Film-Sachbuch
Die USA und ihre Bösen
Post an Dr. Thomas Rothschild
Buchkritiken
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

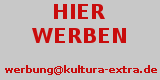
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
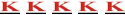
= nicht zu toppen
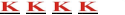
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|