Zum Tod von
Barbara Frischmuth
(1941-2025)
|

Barbara Frischmuth, 2014 | Foto: Franz Johann Morgenbesser; Bildquelle: Wikipedia
|
Barbara Frischmuth hat, als sie sich in jungen Jahren entschied, ungarische und türkische Sprache und Literatur zu studieren, ohne dass ihr dieser Weg durch biographische Vorgaben aufgedrängt worden wäre, bewiesen, dass sie neugierig ist auf das Fremde, das Unbekannte, das Andersartige. Mittlerweile ist sie zu einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit herangewachsen. Ihr Interesse für fremde Kulturen ist aber nicht geschwunden. Immer wieder kehrt sie in ihrem Werk zu Fragen insbesondere der türkischen Kultur zurück. Die Türken aber bedürfen nicht unserer und auch nicht Barbara Frischmuths Toleranz. Sie sind kein Übel, das geduldet werden müsste. Wenn es so scheint, als würde ihnen Toleranz entgegengebracht, so liegt das am Kontrast zur allgegenwärtigen Intoleranz, der sie insbesondere in jenen Ländern begegnen, in die sie auf der Suche nach Arbeit ausgewandert sind und in denen sie zum Teil ihre neue Heimat gefunden haben – was immer das genau bedeuten mag. Und noch ein Zweites kommt hinzu. Die Rede von der Toleranz, derer sich Türken erfreuen dürften, geht sehr oft Hand in Hand mit der Unterstellung, sie selbst seien intolerant. Wer „Türke“ sagt, denkt „Islam“ mit. Und die Hurtigkeit, mit der in den vergangenen Jahren Islam und Fundamentalismus in eins gesetzt wurden, kann einem schon die Sprache verschlagen. Entgegen aller Evidenz ist von christlichem Fundamentalismus kaum je die Rede. Seine täglichen Bekundungen werden als Normalität wahrgenommen. Dabei trägt gerade der antiislamische Eifer unübersehbare Züge des Fundamentalismus. Und Fundamentalismus ist in seinem Absolutheitsanspruch fast immer mit Intoleranz verbunden.
In diesem Kontext ist Barbara Frischmuths literarisches und publizistisches Werk von unschätzbarer Bedeutung. Nicht als Ausdruck der Toleranz, sondern als Bekundung von Interesse, Neugier, Respekt und Zuneigung. Barbara Frischmuth duldet die türkische Kultur nicht – sie liebt sie. Das heißt nicht, dass sie ihre Widersprüche verleugnete, dass sie sie idealisierte. Aber weil sie erfahren hat, was daran schön und auch nachahmenswert ist, wird sie nicht müde, dafür zu werben, zu vermitteln, wo Banausentum Gräben aufreißt, statt Brücken zu bauen. Barbara Frischmuths Romane lassen sich zu einem beträchtlichen Teil als Versuch einer Ablehnung verstehen. Die Ablehnung betrifft den Hang, anderen die eigenen Werte aufzudrängen. Das heißt erst einmal: man muss den anderen und seine Werte kennen lernen, um die Relativität der eigenen Werte zu begreifen. Lessings Ringparabel in moderner Gestalt.
Im Roman Die Schrift des Freundes zum Beispiel wird in langen Passagen, dialogisch aufbereitet, von den Bräuchen und der Geschichte der Aleviten berichtet, von ihrer Literatur und ihren Überzeugungen. Barbara Frischmuths Bücher sind, wo sie sich auf fremde Kulturen einlassen, ethnologische Entdeckungsreisen, die wir Leser unter der kundigen Führung der Autorin unternehmen dürfen. So gesehen steht Barbara Frischmuth, die manche wegen ihrer Vorliebe für Märchenmotive oder für romantische Vorbilder irrtümlich als konservativ einschätzen, in der Tradition der Aufklärung. Aufklärung – in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es Versuche, diese Vokabel zu entsorgen, ihren Anspruch als gescheitert zu verdammen. Mir scheint, dass Aufklärung immer noch ein besseres, ein positiveres Wort ist als Toleranz.
Beim Stichwort Toleranz fallen einem zu Barbara Frischmuth zunächst einmal ihre Bücher ein, in denen sie Fremdes, namentlich Aspekte der türkischen Kultur thematisiert. Aber in Österreich verwechselt man Toleranz gerne mit Standpunktlosigkeit, mit opportunistischem Schweigen zu jeglicher Sauerei, mit chamäleonhafter Anpassung an die jeweilige Umgebung, wenn nicht gar mit der komplizenhaften Beförderung von Unrecht. Als tolerant gilt, wer keine politischen Konsequenzen fordert, wenn Europa-Parlamentarier in der Business Class nach Brüssel fliegen, während die Erhöhung der Pendlerpauschale für Arbeitnehmer, die auf ihr Auto für die Fahrt zum Arbeitsplatz angewiesen sind, stets hinter der Erhöhung der Benzinpreise zurückbleibt.
Toleranz, als Haltung und nicht bloß als Phrase verstanden, muss einhergehen mit Intoleranz gegenüber der Intoleranz. Wer darauf verzichtet, die Intoleranz zu bekämpfen, hat die Toleranz schon in die Defensive gerückt und zum Scheitern verurteilt. Es gibt einen jüdischen Witz, in dem der Blau den Rebbe bittet, seinen Streit mit Grün zu beurteilen. Der Rebbe hört den Blau an und beruhigt ihn: „Du hast Recht, du hast Recht.“ Daraufhin kommt der Grün zum Rebbe und erzählt ihm, mit der Bitte um einen weisen Rat, aus seiner Sicht von dem Streit mit Blau. Der Rebbe hört ihn an und sagt: „Du hast Recht, du hast Recht.“ Die Frau des Rabbiners, die an der Tür gelauscht hat, geht zum Rebbe und meint: „Du kannst doch nicht beiden Recht geben, dem Blau ebenso wie dem Grün!“ Darauf der Rebbe: „Du hast Recht, du hast Recht…“
Wenn das Toleranz ist, dann ist es eine schlechte Toleranz, die eher dem Ruhebedürfnis des Rabbiners als der Gerechtigkeit dient. Wer auch jenem Recht gibt, der im Unrecht ist, fällt dem anderen in den Rücken, dem Recht vorenthalten bleibt. Toleranz gegenüber der Intoleranz entspricht der Gleichgültigkeit gegenüber dem Unrecht und stärkt somit dieses Unrecht. Ihr erstes Buch Die Klosterschule hat Barbara Frischmuth einer Institution gewidmet, der Intoleranz fast zwangsläufig eignet. Das Internat im Allgemeinen und das kirchliche Internat im Besonderen – sie stehen in der Literatur, auch schon vor Barbara Frischmuth und auch nach ihr, für Repression und Unduldsamkeit. Die Ich-Erzählerin, Zögling einer Klosterschule, führt an, worüber sie auf Spaziergängen mit ihrer Freundin Milla spricht. Das liest sich wie ein Katalog der gängigen Vorurteile:
„Es ist auch noch die Rede von Kümmeltürken, Hottentotten, sibirischer Kälte, von der russischen Seele, dem chinesischen Lächeln, der kalmückischen Tücke, von tropischer Schwüle, amerikanischer Freigebigkeit und Lebensweise, von ungarischem Paprika, griechischer Geschwätzigkeit, schottischem Geiz, englischer Lachhaftigkeit, von spanischen Fliegen, der asiatischen Höflichkeit, Eskimo-Küssen, balkanischer Gleichgültigkeit, malaiischer Glätte, von der germanischen Zucht und Sitte, dem jüdischen Pharisäertum, levantinischem Geschäftsgeist, von holländischem Käse, indischen Witwen, türkischem Honig, mongolischer Verheerung, skandinavischer Reinheit, von der Faulheit der Neger, der Eitelkeit der Franzosen, dem Freiheitsdrang der Iren, der Falschheit der Italiener (Katzelmacher), dem Temperament der Sizilianer, von der ägyptischen Krankheit und ähnlichen Dingen, von denen wir keine Ahnung haben.“
Nun darf man die Erzählerin eines belletristischen Textes bekanntlich nicht mit der Autorin gleichsetzen. Wer jedoch die Biographie Barbara Frischmuths kennt, darf schon vermuten, dass in die zitierte Passage eigene Erfahrungen eingeflossen sind. Seit ihren Jahren in der Klosterschule aber hat sich die Schriftstellerin weit von jenen Klischees entfernt, die sie – wenn man die Nachbarschaften der scheinbar assoziativ aneinandergereihten Wortgruppen und den abschließenden Relativsatz beachtet: nicht ohne ironische Distanz – retrospektiv festhält und damit, den kritischen Verstand des Lesers vorausgesetzt, anprangert.
Intoleranz gegenüber der Intoleranz ist die Bedingung für die Möglichkeit dessen, was gemeinhin unter Toleranz verstanden wird. Wir sagten zu Beginn, tolerieren könne man nur, was eigentlich von Übel sei. Dieser Satz soll hier modifiziert werden. Tolerieren kann und soll man, was man für ein Übel hält, was aber in Wahrheit keines ist. Als Übel empfinden viele Menschen, was ihnen nicht gleicht, wir nannten es bereits: das Fremde, das Unbekannte, das Andersartige. Wenn wir Konrad Lorenz glauben dürfen, reproduzieren sie damit das Verhalten der Graugänse. Alle Zivilisationsanstrengungen aber richten sich darauf, dass der Mensch sich anders verhalte als eine Graugans. Ein Blick in die Geschichte könnte die Vermutung nähren, dass diese Anstrengungen nicht sehr erfolgreich waren und es keiner dramatischen Anlässe bedarf, sie rückgängig zu machen. Demgegenüber gilt es, unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebensweisen wenn nicht als gleichwertig, so doch als gleichermaßen schützenswert zu betrachten. In der Sprache der Soziologen hieße das, die Spannung zwischen Autostereotyp und Heterostereotyp, zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung auszuhalten. Barbara Fischmuths Roman Der Sommer, in dem Anna verschwunden war signalisiert schon durch seine Kapitelüberschriften, dass er genau das tut: Er stellt unterschiedliche Auffassungen und Weltsichten nebeneinander, spielt nicht die eine gegen die andere aus, sondern gesteht ihnen ihre je eigenen Gründe zu. Das, so scheint mir, ist Ausdruck einer Toleranz, die, wenn man denn auf dem Wort besteht, diesen Namen verdient. In Barbara Frischmuths Roman gibt es, jedenfalls bis kurz vor dem Ende, keine Täter und keine Opfer, und daher ist eine reziproke Toleranz nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert. Das wird in jeder Zeile des Romans implizit mitgeteilt.
Gegen Ende des Romans entwickelt sich eine Eifersuchtsgeschichte, die sich in jeglichem Milieu abspielen könnte. Annas Liebhaber wird mit der Tatsache konfrontiert, dass die Frau, die zu ihm geflohen war, Schuldgefühle empfindet gegenüber dem Vater ihrer Kinder, mit dem sie fünfzehn Jahre zusammengelebt hat. Der Verehrer wird gewalttätig. Das wäre noch nicht ungewöhnlich. Bemerkenswert ist ein Detail. Er nennt seinen Rivalen nicht bei seinem Namen Ali, er nennt ihn nicht „Annas Mann“, sondern spricht von ihm als „der Türke“ oder „dieser Türke“. Hier ist die Struktur der Intoleranz in der Sprache dingfest gemacht. Der Andere wird nicht als Mensch, nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als Angehöriger eines Kollektivs. Der abwertende Beiklang ist dabei nicht zu überhören. Die psychologisch erklärbare, weil durch Eifersucht bedingte Abneigung vermählt sich sogleich mit rassistisch-nationalistischen Vorurteilen.
Barbara Frischmuth wird von der Literaturgeschichtsschreibung der Grazer Gruppe zugerechnet. Sie ist aber einen anderen Weg gegangen als der Großteil ihrer Grazer Generationsgenossen. Nach experimentellen Anfängen hat sie sich für das üppige, ausgeschmückte Erzählen entschieden. Das hat, scheint mir, mit ihrem Interesse für Menschen zu tun. Dieses Interesse verbindet sie mit dem Vorjahrespreisträger Erich Hackl. Während sich dieser jedoch darum bemüht, die Schicksale realer Menschen möglichst genau zu rekonstruieren, transformiert Barbara Frischmuth die Schicksale, die sie aus der Wirklichkeit bezieht, die sie abfragt, erkundet, beobachtet, zu fiktiven Geschichten in einer Welt voll von Phantasie und Wundern. Barbara Frischmuth hat aus ihrer Affinität zur Romantik nie ein Geheimnis gemacht. Das Interesse an Menschen und ihren Schicksalen aber hat eine fast notwendige politische und ebenso notwendige literarische Konsequenz. Es nötigt zu jener Haltung, die man gemeinhin Toleranz nennt. Und es erfordert das kontinuierliche Erzählen als literarische Methode.
Mit Agitprop hat Barbara Frischmuth gewiss nichts im Sinn. Aber da ihre Bücher in einem gesellschaftlichen Zusammenhang veröffentlicht und gelesen werden, sind sie ein politisches Faktum, ein Dokument nicht nur des Denkens, sondern eben auch des Handelns. Wobei – das müssen wir ergänzen – die Effekte dieses Handelns nicht überschätzt werden dürfen. Sie sind in der Regel kaum zu messen. Die Marktschreier der Intoleranz sind lauter als eine Literatur, wie sie Barbara Frischmuth schreibt. Und dennoch: gäbe es diese Literatur nicht, sähe es um unsere Welt noch schlechter aus, als es ohnedies aussieht.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Protagonisten der Literatur einem realen Modell folgen, ob sie Menschen nachgebildet sind, die tatsächlich leben oder gelebt haben, wie bei Erich Hackl, oder ob sie Erfindungen sind wie bei Barbara Frischmuth. In beiden Fällen begreift der Leser sie als repräsentativ, als Verkörperungen von Ideen, die über die Fabel hinausweisen. Literatur, ob sie stärker dokumentarisch arbeitet wie bei Hackl, oder ob sie fiktional arbeitet wie bei Frischmuth, entwirft immer eine eigene Welt, eine Gegenutopie zur empirisch erfahrbaren Welt. Darin liegt ihr humanistisches Potential, ihre Aufforderung zu jener Haltung, die wir mangels eines anderen Wortes „Toleranz“ nennen wollen. Sie enthält immer schon die Möglichkeit des Andersseins in sich und ermutigt dazu, sich auf dieses Andere einzulassen, mehr noch: es als Bereicherung zu erfahren. Die Leser von Hackl und Frischmuth brauchen Sidonie, Aurora, Rudi Friemel, Margarita Ferrer, Hikmet Ayverdi oder Inimini, die vierzehnjährige Tochter einer Österreicherin und eines Türken, die eine Identität sucht, nicht zu tolerieren, weil sie sie dank der Überzeugungskraft von Literatur lieb gewonnen haben.
Barbara Frischmuth ist gestern, am 30. März 2025, in ihrem geliebten Geburtsort Altaussee gestorben.
|
Thomas Rothschild – 31. März 2025
ID 15212
Weitere Infos siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Frischmuth
Post an Dr. Thomas Rothschild
Nachrufe und Porträts
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:

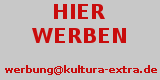
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
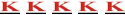
= nicht zu toppen
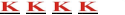
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|