|
Wie die Wörter anheimeln und heimelig
ein Heimatgefühl vermitteln
|
Ich las es in der Appenzeller Zeitung: „Die Mitglieder des Samaritervereins Mogelsberg richteten das Buffet anheimelnd her und sorgten sich um ihre Gäste.“ Den Artikel illustrierte ein Foto mit beeindruckenden Leckereien, die den umstehenden Gästen sichtbar das Wasser im Munde zusammenlaufen ließen.
Ich überlegte, ob der Schreiber wohl schon einmal von dem radikaldemokratisch gesinnten Arzt und Publizisten Titus Tobler gehört hat, der von 1853 bis 1857 für den Kanton Appenzell Ausserrhoden im Nationalrat saß und neben seinen medizinischen und politisch-journalistischen Schriften auch einen bis heute anerkannten Beitrag zur frühen alemannischen und deutschen Mundartforschung geleistet hat. In seinem 1837 in Zürich erschienenen Werk Appenzellischer Sprachschatz wollte er nämlich wissen: „Wie gibt der Hochdeutsche das oberdeutsche heimelig, anheimeln, anheimlich wieder?“ – nachdem er zuvor festgestellt hatte: „So reich das hochdeutsche Wörterbuch ist, so wenig lässt sich in Abrede stellen, dass immer noch Ausdrücke darin mangeln, womit nun einmal bestimmte Begriffe bezeichnet werden.“
Ein milder Stolz, der aus Toblers Frage spricht, ist berechtigt, denn es hat rund ein halbes Jahrhundert gedauert, ehe das Wort auch in Deutschland zunächst in der hochdeutschen Schriftsprache angekommen und später auch von der Allgemeinsprache aufgenommen wurde. Das liegt nicht zuletzt an der Endung. „Die Bedeutung der oberdeutschen Endung -eln ist“ – so umschrieb es 1937 (also 100 Jahre nach Tobler) der österreichische Sprachforscher Adolf Josef Storfer in seinem Werk Im Dickicht der Sprache – „,nach etwas riechen oder schmecken (z. B. hundeln, wildeln, säuerlen, fischelen, fleischelen, räuschelen, böckelen, füchselen)‘. Etwas heimelt mich an bedeutet also: es wirkt mit seinem Wesen (seinem Geschmack, seinem Geruch) so angenehm auf mich, dass ich mich wie zu Hause fühle.“
Völlig erfassen können wir die Grundbedeutung der Verben heimeln und anheimeln erst, wenn wir das Werk zur Hand nehmen, das Franz Joseph Stalder, der Dekan und Pfarrer zu Escholzmatt im Entlebuch, 1812 unter dem Titel Versuch eines Schweizerischen Idiotikon mit etymologischen Bemerkungen untermischt in Aarau herausbrachte. „Dieser Zeitwörter heimeln, anheimeln“, so weiß Stalder, „bedient sich der Schweizer besonders in den Augenblicken der Weihe, wenn er nach jahrelanger Trennung wieder einmal den heimatlichen Herd betritt, wo er sonst ehedem so vergnügt wandelte, oder wo sich auch mannigfaltige Verschlingungen und Knoten seines Erdlebens entwirrten – oder wenn eine rege Phantasie ihm in lieblichen Bildern vorzeichnet mehrere Berührungspunkte seines Selbst mit einer ehevorigen Lage, oder wenigstens eine örtliche Ähnlichkeit in Vergleich mit einem alten Wohnsitze; dann ruft der Schweizer im Taumel des Entzückens auf: der Ort heimelt mich an.“
Dass nicht nur Orte und Personen, sondern selbst Maschinen ein Heimatgefühl vermitteln können, verrieten schon Berthold Auerbachs 1843 publizierte Schwarzwälder Dorfgeschichten: „In dem großen Feldgebreite nicht weit vom Hause Ivos sah er die Mähmaschine in Bewegung, und das war ihm wie ein Heimatsgruß. Und warum soll eine Maschine nicht auch anheimeln können so gut wie Posthornklang?“
Natürlich hat auch das Gegenteil seine Gültigkeit: „So heimeln Gegenstände, die mit denen in der Heimat Ähnlichkeit oder gleiche Eigenschaften haben, an; aber ein Galgen, der nur unangenehme Erinnerungen erneuern könnte, heimelt nicht an, möchte er immer sehr ähnlich, ja gleich sein“, schrieb Titus Tobler. Und kürzlich konstatierte die NZZ: „Das Industriequartier von Vaduz wirkt wenig anheimelnd.“
Der Spinoza-Übersetzer Berthold Auerbach, der der Erzählgattung der Dorfgeschichte ihren Namen gab, der Autoren wie Balzac, Turgenew und Tolstoi beeinflusste, hat auch bei deutschen Schriftstellern zu einer Verbreitung des oberdeutschen, besonders schweizerischen Verbs anheimeln beigetragen. „Es musste dich doch recht anheimeln, Eduard, als du neulich den Fuß wieder hersetztest?“ heißt es in Wilhelm Raabes Roman Stopfkuchen (1891), und bei Otto Julius Bierbaum lesen wir in den Freiersfahrten und Freiersmeinungen des weiberfeindlichen Herrn Pankrazius Graunzer (1896): „Ich muss sagen: anheimeln tut mich's nicht, aber Respekt zwingt mir's ab.“ Man kann also Friedrich Kluge nur zustimmen, der 1912 unter dem Titel Anheimeln in einem seiner Aufsätze zum deutschen Sprachschatz resümierte: „Wenn unser Wort um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts sich die Literatur langsam erobert, so teilt sich die Schweiz und der Schwarzwald in das Anrecht auf unser Wort.“
Dass auch heimelig inzwischen in der deutschen Umgangssprache geläufig ist, bewies schon ein Brief, den Albert Einstein am 25. Juli 1931 an seinen Architekten Konrad Wachsmann schrieb: „Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mich noch an keiner Stelle und in keiner Behausung so wohl und heimelig gefühlt habe.“
Christoph Gutknecht - 24. April 2019
ID 11367
Post an Prof. Dr. Christoph Gutknecht
https://www.slm.uni-hamburg.de/iaa/personen/ehemalige-emeriti/gutknecht-christoph.html
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeige:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
ETYMOLOGISCHES
von Professor Gutknecht
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
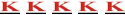
= nicht zu toppen
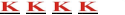
= schon gut
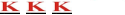
= geht so

= na ja

= katastrophal
|