|
Tschaikowski etc.
|

|
Bewertung: 
In den vergangenen Jahren haben skandinavische und baltische Dirigenten, allen voran Mariss Jansons, in überproportionaler Zahl die Konzertsäle und die Herzen der Deutschen erobert, unter ihnen auch Jansons‘ um eine Generation jüngerer Landsmann Andris Nelsons. (Das "s" am Ende der Namen kennzeichnet im Lettischen das männliche Geschlecht.) Ob es an der gemeinsamen Geschichte innerhalb der Sowjetunion liegt oder an der geographischen Nähe – jedenfalls scheinen baltische Dirigenten eine Affinität zu russischen Komponisten von Tschaikowski bis Schostakowitsch zu haben.
So bilden auch die letzten drei Sinfonien Tschaikowskis den Kern einer Box mit drei DVDs oder Blu-rays mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester Leipzig mit zum Teil wechselnder Besetzung, die auch einzeln verkauft werden. Außer den Tschaikowski-Sinfonien enthalten die Aufzeichnungen Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, KV 550, Modest Mussorgskis Morgendämmerung an der Moskwa aus seiner Oper Chowanschtschina, Schostakowitschs Violinkonzert Nr. 1 in a-Moll, op. 77, sowie Mieczysław Weinbergs Trompetenkonzert in B-Dur, op. 94. Drei Russen, ein vor der Wehrmacht in die Sowjetunion geflüchteter Pole und Mozart: eine gute Mischung und hinreichend Gelegenheit für einen Dirigenten, die Spannweite seiner Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Während Nelsons Tschaikowskis 4. Sinfonie mit dem eingängigen Volksliedthema von "Vo pole berëza stojala" (dt.: Im Feld stand eine Birke) solide, aber ohne besondere Überraschungen interpretiert, gelingt es ihm, der so oft gehörten 5. Sinfonie durch Dynamik und Tempi eine ungeahnte Spannung zu entlocken. Er beginnt den ersten Satz, in dem das spätere Revolutionslied Brüder, zur Sonne, zur Freiheit anklingt, das wiederum auf das russische Volkslied "Medlenno dwižetsja vremja" (dt.: Langsam bewegt sich die Zeit) zurückgeht und sich durch alle vier Sätze zieht, extrem langsam und leise und steigert ihn bewegt und differenziert.
Auch die 6. Sinfonie, die Pathétique, startet Nelsons ungewöhnlich langsam. Der erste Satz dauert gut zwei Minuten länger als bei Karajan oder bei Petrenko, manche Aufnahmen der ganzen Sinfonie sind erheblich kürzer als seine. Der lettische Dirigent nimmt die Vortragsbezeichnungen con grazia und lamentoso des zweiten und des vierten Satzes äußerst ernst. Dem dritten Satz verleiht er wiederum eine atemlose Spannung. Das klingt wie ein Western avant la lettre, der keine Bilder benötigt. Die Musik evoziert sie.
Weinbergs Konzert von 1967 mit dem überragenden schwedischen Trompeter Håkan Hardenberger als Solist bestätigt einmal mehr die Meisterschaft des mit jahrzehntelanger Verspätung entdeckten Komponisten, dessen Bedeutung Schostakowitsch immerhin erkannt hat. In den vergangenen Jahren wurde nachgeholt, was man zuvor versäumt hat. Weinberg hat sich in der Schallplattenproduktion und im Konzertbetrieb den Platz erobert, der ihm zusteht. Auch das Trompetenkonzert hat sich seinen Weg ins Repertoire gebahnt, wohl nicht zuletzt wegen des effektvollen Soloparts, der übrigens durch längere solistische Passagen der Querflöte und sparsamer auch der ersten Violine und eines Cellos ergänzt wird. Nelsons dirigiert konzentriert und sorgt für die exakten Einsätze aus dem Orchester, das bei diesem Stück enorm gefordert ist.
Die lettische Geigerin Baiba Skride spielt das Violinkonzert von Schostakowitsch kontrastreich, (weiblich?) warm auch in seinen düsteren Partien und virtuos. Als Zugabe, als Verbindungsglied zwischen Schostakowitsch und Tschaikowski, präsentiert Baiba Skride die Elegie für Violine solo von Strawinski, die nach dem Willen des Komponisten auch von einer Viola gespielt werden kann.
Was soll man zu Mozarts vorletzter Sinfonie noch sagen, was nicht schon gesagt worden wäre? Auch Nelsons kann keine Wunder vollbringen. Was vielleicht auffällt, ist die Hervorhebung des dialogischen Charakters der Komposition und der Instrumentation im vierten Satz, einer Art musikalisches Frage-und-Antwort-Spiel, der wohl dosierte Umgang mit dem Vibrato (Norrington wäre noch nicht ganz zufrieden) und ein Konzertmeister, der ein wenig aussieht wie eine Kreuzung aus Paganini und Roberto Begnini und sich sichtbar ins Zeug legt.
Im Gewandhaus mit mal rot, mal blau ausgeleuchteten Orchesteremporen: ein hervorragendes Publikum, das „sein“ Orchester merklich liebt, beim Applaus aber deutliche Unterschiede macht.
*
Für die Kamera gibt Andris Nelsons weniger her als, sagen wir, Leonard Bernstein oder Gennadi Roschdestwenski. Er gehört zu den eher zurückhaltenden Dirigenten, ohne ausholende Gesten und expressive Mimik, mit einer unspektakulären Stabführung. Und doch kommt ein Konzert im Video anders herüber als im Konzertsaal. Darf man das noch äußern: Ich gestehe, dass ich bei filmischen Übertragungen von Konzerten immer wieder an einzelnen Gesichtern hängen bleibe. Ihnen eignet die Schönheit der Konzentration. Da bleibt kein Raum für Koketterie. Sie haben die Qualität eines Porträts von Vermeer oder von van Dyck. Und ehe ich nun gescholten werde wegen der Nennung von Äußerlichkeiten: klar, was zählt, ist die Musik. Deshalb kauft man sich ja diese DVDs und nicht ein Pin-up.
Thomas Rothschild – 1. Dezember 2020
ID 12633
Accentus-Link zur
Nelsons-Box
Post an Dr. Thomas Rothschild
CD | DVD
ROTHSCHILDS KOLUMNEN
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:

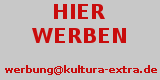
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
CD / DVD
INTERVIEWS
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
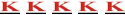
= nicht zu toppen
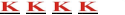
= schon gut

= geht so

= na ja

= katastrophal
|