Dem böhmischen Zentrum Prag, der Stadt, die auf einem Realmythos gründet und unbewusst daran glaubt, dass die universal-gerechte Herrschaft Libusěs eines Tages wiederkehrt, ist die Oper ureigenste Ausdrucksform. Solange diese Urzeit des Glücks jedoch fern bleibt, wartet man traurigen Augs oder musiziert, komponiert, spielt, rennt gegen den Wahnsinn an, der sich in der über tausendjährigen Stadtgeschichte so oft und mehr als anderswo ereignete: Sei es durch Intrige, Pest, Brand, Katholizismus, preußische Soldaten (unter Friedrich II.), sei es unter Wiener Observanz, sei es als „Reichsprotektorat“ Hitlerdeutschlands oder unter der Sowjetknute. Oder sei es durch heutige Touristenfluten, die auf ihren billigen T-Shirts versprechen „bis an die Kotzgrenze zu gehen“, nicht wissend, das ihre Opas die hier bereits für alle Zeiten überschritten haben.
Doch hat Prag jede Menge eigene Probleme und Nöte, an denen man, will man sozial verantwortungsvolles Theater oder Oper machen, nicht vorbei gehen kann: Die Löhne sind niedrig, viele Menschen haben überhaupt kein Einkommen, sind Abjects der Globalisierung; in vielen Vororten regiert der Asphalt oder gleich der Gaga in Form neu-künstlicher Einkaufszentren. Dazu werden gerade dort, unweit des Zentrums, Bauvorhaben geplant, die das Stadtbild so nachhaltig beschädigen werden – Towers vs. Hradschin –, dass die UNESCO überlegt, das Weltkulturerbe zurückzunehmen. Hier gibt es Minister, die öffentlich die Klimaveränderungen negieren, während der Sommer fast das Trinkwasser leergesogen hat. Hier implodiert die Innenstadt unter fabrikartigem Tourismus, wobei nicht nur die Kellner zu Taschenrechnern geworden sind; hier gibt es kaum Radwege und keine vernünftige Tageszeitung mit einem kunstsinnigen Feuilleton. Das heißt die tatsächlichen Leistungen von Bühnenkunst werden gar nicht oder nur marginal gewürdigt. Denkt man an „den rasenden Reporter“ Kisch, an die Feuilletons vom Schwejkautoren Jaroslav Hašek und vielen, vielen anderen in dieser Stadt zurück, überfällt einen das kalte Grausen angesichts dieses Ekeljournalismus. Somit müssen die Theater – ähnlich wie in Deutschland – selber Hefte herausbringen, wo sie die Besucher informieren, Inszenierungen erklären, Interpreten vorstellen.
Was sie auch tun: das Národní divadlo, das mit seinem Ensemble und Orchester das Ständetheater und das Nationaltheater bespielt, besorgt neben niveauvollen, aber normalverständlichen englisch- und deutschsprachigen Programmheften zu jeder Inszenierung, monatlich ein Heft und die Staatsoper neben dem Hauptbahnhof alle drei Monate. Möchte man nun etwas über den Leistungsstand eines Opernhauses erfahren, darf man sich aber nicht durch Bildchen in Heften oder durch glanzvolle Premieren ansprechen lassen, sondern muss das Repertoire anschauen. Denn was sagt mehr über die Leistungsfähigkeit von Opernhäuser aus als eine 92. Vorstellung von “Le nozze di Figaro”, eine 106. „Carmen”, eine 93. “La traviata” oder eine 49. “Rusalka”? Ein Qualitätsmerkmal ist, wenn das Repertoire nie nicht wie Repertoire wirkt, sondern wie just produziert: Das ist im National- und Ständetheater in den vier besuchten Vorstellungen durchweg der Fall, in der Staatsoper Prags einmal ja, einmal nein.
Mozart am Originalschauplatz: Ständetheater
Bereits äußerlich ist das Ständetheater ein Segen: Gestiftet von Nostitz, nachdem das Theater in den Kotzen pleite gegangen war, schenkt es einen unverstellten Einblick in die Klassik, in die Zeit Mozarts. Hier haben die Prager, nachdem der Figaro einschlug wie ein ästhetischer Komet, und vor allem Impressario Bondini für den Kompositionsauftrag und die Uraufführung des „Don Giovanni“ gesorgt. An diesem Pult haben Mozart, Carl Maria von Weber und Bedřich Smetana gestanden.
|

Ständetheater in Prag
|
Ort verpflichtet: Die werkverständige Figaro-Inszenierung von Josef Průdek aus dem Jahre 2002 sprüht vor frischer Vitalität, witzigen Bonmots und rührenden kitschunverdächtigen Episoden. Wenn Graf Almaviva zum Golf-Abschlag ausholt, auf dem Grün, das im vierten Akt zur Spielwiese der Intrige und der Versöhnung wird, wenn Cherubino und die Gräfin – wie Beaumarchais weiter ausführt mit Folgen – sich küssend begehren, wenn Susanna Figaro durchwalkt oder für Cherubino in den Wandschrank geht oder die Gräfin in dem morbide gewordenen Seitenmauerwerk (Bühnenbild: Jan Zavarsky) trotz weiterhin bewölkt bedrohlichem Himmel verzeiht, so möchte man von all dem nichts missen.
„Le nozze di Figaro“ hört man, vor allem in den weiblichen Partien, wohl kaum auf der Welt so durchweg hochkarätig besetzt, wie hier: Allen voran liefert das lyrische Mademoiselle Silberklang des Nationaltheaters, Petra Nôtová, ein umfassend natürliches Portrait der Susannapartie: man hört (und sieht) sie um Grade lieber als die großkehlige Anna Netrebko oder die eine Idee zu metallische Patrizia Ciofi. Cherubinos Ohrwurm „Voi che sapete“ leuchtet die Mezzosopranistin Jana Štefáčková genauso feinnervig aus wie die gesamte Partie dieses Cupido: eine Glanzleistung. Vom „Porgi, amor“ über das „Dove sono i bei momenti ...“ bis zur Versöhnungsszene stiftet die ein wenig zum Grimassieren neigende Sopranistin Iveta Jiříková eine ergreifend tränenbezwingende Interpretation der Gräfin – wenn auch die Linien ein teilweise noch höheres Maß an Bindung vertrügen. Vom sympathisch spielfreudigen Bass František Zahradníček wünschte man sich einen verstärkteren Einsatz von Brustresonanz. So klingt sein „Non piu andrai!“ allzu softyhaft. Und Martin Bárta gibt dem Grafen Almaviva weniger ein galantes als ein viriles, willensbestimmtes Gesicht, was zu der Inszenierung gut passt: vom Stimmtyp her eher der ideale Bariton in der italienisch-romantischen Oper, der das Liebespaar stört. Aus dem weiteren Ensemble ragt der Titus-Tenor Jaroslav Březinas (Basilio) und der warmtimbrierte Sopran Alžbĕta Poláčkovás (Barbarina) heraus.
Dazu kommt eine besondere, wohl spezifisch böhmisch zu nennende Musizierlust des Orchesters unter dem theaterversierten Kapellmeister Jan Chalupecky, die dieser die Buffotradition überwindende Opera buffa zu ihrem filigranen Glanz verhilft: Ein Gesamtkunstwerk auch in der gelungenen Einbindung von Chor und Tonbandgeräuschen, das jedem Besucher den unbequemen Sitzplatz vergessen lässt. Im Schlussgesang löst sich die Grenze zwischen Zuschauerraum und Bühne: Es wird nicht mehr um einer Handlung Willen gesungen, sondern der innere Mensch selber ist gemeint. Eine szenisch voll eingelöste Grenzüberschreitung Mozarts.
Ebenfalls Sonne: Die 2006 von Herrmann und Herrmann inszenierte und eingerichtete Krönungsoper (für Leopold II. zum böhmischen König – was insgesamt nur wenige Habsburger überhaupt für nötig hielten) „La clemenza di Tito“. Sie begegnet in einem als Zentralperspektive zugeschnittenen weißen Raum, als dessen Entree das Symbol der Macht, des Titus Krone oder später der leere Haken, fungiert. Am Ende des in die Bühnentiefe führenden Gangs lassen sich Bilder aufschlagen, wie in diesem Kinderkinospielzeug. Wodurch die Zentralperspektive – das wesentliche Kunstprinzip der bildenden Kunst in der Neuzeit – immer wieder angefragt wird, gleichwie die Formstrenge der Opera seria mit ihrem formalen Bezugsgespann von Affekt und Arie, Handlung und Rezitativ, von Mozart nicht nur auf den Prüfstand gerät (was das Urteil der Kaiserin, der Tito sei eine „deutsche Schweinerei“, zwar nicht entschuldigt, aber erklärt). Diese Musik problematisiert die Gattung, die den Anfragen der Regie wie die nach dem Verhältnis Person, Motiv und psychischem Affekt Steilvorlagen bietet und in diesem zugespitzten und über zwei Akte niemals abstehenden Raum kolossale Wirkungen zu entfalten vermag; vor allem, wenn man mittig sitzt. Ein Höhepunkt ist bereits der unecht-echte Auftritt des Tito zu den prolligen Trompetenfanfaren: Ein neurasthenisch überreizter Herrscher verteilt erst einmal seine Qualinsignien. Und will gar nicht so recht. Krönung? Liebe? Andere Menschen beherrschen? Alles ist ihm reichlich stressverursacht. Beglaubigt wird das durch den sonoren wie geschmeidigen Tenor Jaroslav Březinas in Höchstform: seine darstellenden Qualitäten lassen das strukturale Psychogramm dieses Plots um eine vom Willen zur Macht über Schmerz um Vergebung bittende Vitellia und den zwischen Liebe und Aufrichtigkeit zerrissenen, schließlich zum Tode verurteilten Sesto zu einem wahren Krimi werden, einem Krimi mit umgekehrtem Ende: statt der naheliegenden Rache-Strafe herrschen Milde und Sanftmut.
Selbst in den von Süßmayr komponierten Seccos spielt das sechsköpfige Ensemble das späte Mozart-Stück in Rage: Die Entwicklung Sestos, hier im Anzug, vom fahlen Mitmacher zum ehrlich sich Freiredenden erreicht eine peu à peu mit mehr Farbe agierende Atala Schröck. Ihr schlanker Mezzo leistet in dem heftig anspringenden Accompagnato schier Unglaubliches und bewerkstelligt die heftigen Intervalle dieser Partie makellos. Vitellia begegnet als musikalische Waffe, mal im roten, mal im veilchenfarbenen Kleid. Oder vielmehr ist wohl das Kleid ihre Waffe? Den Namen Pavla Vykopalová jedenfalls sollte man sich dazu merken: eine dem Zwischenfach entfleuchte Sopranistin mit weiblichem Timbre, die aus einer satten Tiefe agiert, warme wie kalte Töne produzieren und gleichsam dramatische Akzente setzen kann; dabei intonationssicher wie diszipliniert ist und über ein szenisches Bios verfügt, das vielen Zuschauern sicher Fieber verursacht. Katerina Jalovcová gibt dazu einen süßen wie eloquenten Annio und Petra Nôtová eine exzellent phrasierende Servilia. Die Sänger werden in dieser Apparat und Gesang oftmals konfrontierenden Oper durch ein auf Klangbalance angelegtes Dirigat von Marko Ivanović gehalten, einem Dirigat, dem es an der Herausarbeitung von Schärfen und Unschärfen nicht mangelt. Insgesamt überzeugen Tempowahl wie dynamische Differenzierungen. Letztere gelingen auch dem Chor – in schroffen Wechseln von Piano und Forte – überaus einprägsam. Am Ende nagelt die Zentralperspektive unsere Sicht auf den Gletscher fest. Alles steht still, alles ist quasi Form-Sache; die Tat bedingt eindeutige Strafe. Ende, aus. Erst Menschen könnten hier wohl etwas ändern: Und Titus, der soviel Gesang, soviel wahrhaftigen humanen Ausdruck erfahren hat, will wohl doch einer werden...
Beide Mozart-Inszenierungen erweisen sich als jeweils werkprägende Lesarten auf allerhöchstem künstlerischen Niveau. Es ist fraglich, ob derzeit im Mozart-Repertoire überhaupt irgendeine andere Stadt mit dem Prager Ständetheater konkurrieren kann.
Carmen und La Traviata: Zwei Kracher im Nationaltheater
Neben Tosca sind wohl Carmen und La Traviata die Klassiker des Repertoires. Doch gerade derlei Opern inszenieren sich äußerst schwierig. Zu hoch ist der Anspruch. Zu viel Ideen trägt der Betrachter selber heran. Man kann von daher mit Reduktion der Mittel arbeiten, wie in Deutschland seit Wieland Wagner üblich, man kann aber – das zeigen beide Inszenierungen am Nationaltheater – auch durch die Fülle der Theatermittel Ballett, Choreographien (bei Carmen: Libor Vaculic), große Chor-Ensembles (Einstudierung: Pavel Vaněk), Kostümwechsel und üppige Bühnenbauten hindurch den schließlichen Intimitätsgrad beider Werke erreichen. Man muss an dieser Stelle auch einmal offen sagen, dass als maßstabsetzend gefeierte Inszenierungen wie die Bremer Carmen von Karin Beier gegenüber Aufgebot und Stringenz, welches die Prager hier zeigen, sich eher wie ein netter, letztlich aber hoffnungslos harmloser Versuch über Carmen ausnimmt. Der slowakische Regisseur Josef Bednárik erweist sich als wahrer, durchaus im Felsensteinschen Verständnis authentischer Verwirklicher großer Tableaus und Massenszenen, wie diese geschmacksbildende Opera es verlangt, gleichwie als Meister dialektischen Theaters, das absolute poetische, fast surreal zu nennende Tableau-Bilder oder Unterbilder wie das erinnerungsmotivisch angelegte von Don José’s Mama im Sakralkostüm hervorzubringen versteht. Alles ohne auch nur ein gängiges Carmenklischee zu bedienen: Eher bedeutet für Bednárik die Anpassung Carmens ans Klischee genauso den Tod wie die Anpassung an eine kastillianische Aufstiegsmentalität des Torreadors oder die Liebe zu dem gefühlskneifenden Basken Don José. Niemand von den Mannen kann ihr die ihr wesenseigene Freiheit geben. Denn das Terrain ist von vornherein umzäunt: Suchscheinwerfer, hochgezogener Machendraht, man fühlt sich zu Hause wie in Leos Janacek’s Totenhaus. Selbst die musikalisch versprochene Natur im dritten Aktvorspiel kommentiert Bednárik krass als zerrissene Briefmarke aus „Extremadura“: projizierte Touristenharmonie; wahre Natur setzte gerade die Freiheit voraus, die die Welt Zunigas allen – die mitmachen oder auch nicht mitmachen – versagt. Hier liegt vielleicht ein Kritikpunkt dieser unglaublich dichten Arbeit: Man hätte die Figur Zunigas (solide: Aleš Hendrych) deutlicher konturieren können, denn hinter der Unfreiheit für alle stecken doch recht handfeste menschliche Interessen. Am Ende kann man dann auch geteilter Auffassung sein: Carmen läuft, nachdem er sie fast schon ersoffen hatte, ins Messer und ist selbst die im Tod befreite Natur auf dem Brunnen, auf die sie hoffte: Ein merkwürdig friedliches Bild. Danach wird ein schnelles Standgericht über Don José hineingeblasen und vollstreckt, was wohl eher bei Puccini seinen Platz hat.
|
Ein wenig Schade angesichts dieser sicher auch beim fünfmaligen Besuch noch spannenden Carmen wie auch angesichts der gesanglichen und deklamatorischen Fähigkeiten der Sänger, ist es, dass nicht die Dialogfassung, sondern die Guiraud-Fassung gegeben wird. Wogegen im Übrigen auch das jeden Habanera-Kitsch vergessen lassende, extrem langsam gedrehte Tempo bei der Habanera und der Seguidilla sprechen (Am Pult: Zbynĕk Müller). Ohnehin bezirzt das Orchester in den solistisch getragenen Passagen vollkommen, könnte atmosphärisch aber insgesamt noch eingeschliffener und zugespitzter daherkommen. Wer die L’Arlesienne-Suite-Zugabe des Strauss/Sibelius-Konzerts im Dvorak-Saal des Rudolfinums mit dem WDR-Sinfonieorchester unter Semjon Byčhkov gehört hat, weiß sofort, wie geschliffen, geradezu schostakowitschartig Bizet klingen kann. Aber Bizet ist eben wohl kein tschechischer Meister. Gesanglich ragt vor allem die Carmen von Jolana Fogašová hervor: Mit herbem Timbre, dunkler Wucht und sexy Höhen singt diese auch äußerlich durchaus Merimées widersprüchlichen Schönheitskriterien entsprechende Carmen sich in die Herzen der Zuschauer. Die anderen Solisten überzeugen nicht durchweg: Valentin Prolat (Don José) weiß sich zu steigern und imponiert nach anfänglich nur magerer Beseelung des Tons mit konvulsiven Ausbrüchen und einem stabilen empfindungsgeladenen Höhenforte. Helena Kaupová als Micaela phrasiert bei schöner Tongebung öfter ungeschickt, Martina Bauerova als Frasquita quiekt, Stanislava Jirku bleibt als Mercedes blass – das Kartenterzett ist ein Reinfall. Der Escamillo von Jiři Sulženko ist in jeder Hinsicht glaubwürdig, nur Carmen glaubt ihm seine Liebe nicht, singt: „Eescaaahamiiiillo“. Und der Chor ist, wie stets im Nationaltheater in seinen frühen Pianowirkungen genauso eine Wohltat wie bei seinem strahlenden „Liberté“ zum zweiten Aktausgang, gleichwie auch das Ballett hier tolle Einfälle präsentiert, wie junge Herren im Carmenlook, die wenig Zweifel an der Hispanokritik aufkommen lassen: Spanien ist hier der Carmen ihr Tod.
Desgleichen gilt für das Verhältnis von Italien und Violetta Valery keineswegs. Man hat Violetta – naheliegend – geradewegs importiert. Aber keineswegs billig, sondern man zeigt, im guten Sinne museal, dass Hurerei einmal geschmackvoll zuging in Europa, ja in Tschechien. Die Rückblende Violettas – im zartglimmend morbiden Vorspiel ist sie bereits sterbend im Bett zu sehen, umgeben von weißen Masken – spielt in spätromantisch, eine Mischung aus Mucha-Ästhetik und Bildauszügen von Karel Špillar komponierten Intérieurs, gerahmt in antikem Tragödienrund. So beginnt der erste Akt und eigentlich könnte man sich jetzt sachte zurücklehnen und das stimmfreundliche, Alfredo (in warmem runden Ton: Tomáš Juhás) gut auf Kurs setzende Dirigat Jan Chalupeckýs genießen oder die Crescendo- bzw. Decrescendowirkungen des Chors oder einen alternden, aber wackeren Giorgio Germont (Ivan Kusnjer) beobachten. Allerdings macht das gemütliche Zurücklehnen Marie Fajtová von der ersten Minute an zunichte, vielmehr noch als ihre Lulu-Figur ihr Gesang: In Bann schlägt ihr callasartig changierendes Timbre, ihre 1A-Koloraturen, ihre aufstechenden Acuti und überhaupt die vokale Beherrschung dieser maximale Anforderungen stellenden Partie, die sie im Gegensatz zu Anna Netrebko in Salzburg als Entwicklung zu begreifen versteht: in der Höhe wird sie zwar schmaler, aber nie dünn oder fahl. Ihre Deklamation ist ent- wie verzückend und ihre Briefszene gelingt. Wenn sich zum „Addio, del passato“ die Ränge des ehedem Bordellintérieurs mit Zuschauern, zum Teil bewaffnet mit Opergläsern, füllen, gefriert einem das Schlaggerät in der Brust. Gewiss, vermutlich sollte man diese Diva des Národní divadlo – ausgebildet am Prager Konservatorium – nicht zu früh, zu viel loben. In drei Jahren wird sie diese Partie sicher um einiges differenzierter, nuancierter, auch metallischer zu nehmen verstehen. Nichtsdestotrotz erwartet man ein derart absolutes Gesangsniveau auf der Szene erst einmal kaum mehr: Um diese Violetta werden noch viele Menschen auf der Welt weinen. È strano!
|
Das Streben nach etablierter Upperclassoper: Rusalka und Rigoletto an der Staatsoper Prag
An dem ehemalig neuen deutschen Theater (Fellmer und Hellmer), dann seit dem 2. Weltkrieg Smetanovo divadlo, seit 1992 die Staatsoper Prags kommt Verdi’s „Rigoletto“ gänzlich ungeschminkt daher, während Dvořák’s Elfenmärchen „Rusalka“ mit facettenreichem Tanz und medialer Unterstützung aufwartet. Und so ist auch der Rigoletto eher eine müde Repertoireveranstaltung, während Rusalka sich wirklich lohnt. Am Ende weiß man nicht recht, was einen da am Meisten gestört hat: der dauernde Krumlauf von Richard Haan, die verpatzte Arie „Gualtier Maldé“ der Gilda (M. Vyskvorkina), oder der unagile, etwas arg prollige Herzog von Mantua (Tomáš Černý). Diese getreue Inszenierung jedenfalls wäre mit anderen Sängern wohl durchaus noch ein Erlebnis. Genauso wie der nur zu Beginn zeitweilig behäbige, unzwingende Orchesterklang unter Leitung von Michael Keprt sich bis zum Schlussakt durchaus zu steigern versteht. Am Ende gab es für die vokal zu schwache Staatsopernleistung einige deutliche Buhs, die selbst ein sich ausprobierendes holländisches Schülerknäuel nicht niederzubrüllen vermochte.
|
Erst Alexander Zemlinsky sorgte in den zwanziger Jahren dafür, dass hier unter anderem tschechische Werke gespielt wurden; heute ist das normal: Rusalka ist eine farbenreich impressionistische Oper, weniger ein Drama, mehr mythische Sehnsucht als Realität auf Grundlage des Undine-Mythos. Und so herrscht vom ersten Takt an eine große poetische Strahlkraft der Szene (Regie: Zdenek Troška), eine signierte Waldaura, die durch filigranstes Wetterleuchten (Harfe, Oboe) aus dem Graben getragen wird (Leitung: Frantisek Drs). Ein Gesamtkunstwerk entblättert sich um dieses stets traurige, beseelt gerade nicht in der Sprache der Mitteilung kommunizieren könnende Waldmädchen Rusalka. Ihre Mondarie wird unter der Vitellia-Interpretin Pavla Vykopalová zu einem Gesangsgedicht. Eine auch im Zusammenklang mit Tomáš Černý, der als Prinz eine bessere Figur denn als Herzog von Mantua abgibt, berauschende gesangliche, wie szenische, wie orchestrale Darbietung an der Staatsoper Prag.
Opern leben
Eines wird deutlich: Das besondere am Opernleben Prags, ist dass Opern hier lebendig werden. Gerade im Alltag, im Repertoirebetrieb. Zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland Opern kaum billig genug produziert werden müssen, und in Italien legendäre Opernstädte ganz schließen, ist Prag also eine sichere Bank. Die Gesangsqualität ist, wie allein die vorgestellten Sopranistinnen – die Mezzosopranistin Jolana Fogašová, die lyrische Petra Nôtová, der Koloratursopran Marie Fajtová und die jugendlich-dramatische Pavla Vykopalová – zeigen, in allen Stimmfächern außerordentlich. Im neunzehnten Jahrhundert wären die Klügeren allein wegen dieser Stimmen nach Prag gereist. Auch scheint in Tschechien und der Slowakei die Stimmausbildung mit den darstellenden Fähigkeiten nicht zu kollidieren, im Gegenteil: es herrscht eine extra zu erwähnende Bühnenpräsenz und Schauspielleistung, insbesondere am National- und Ständetheater. Letzteres bietet zudem Regisseure auf, die das Musiktheater von innen her auszuleuchten verstehen und den Betrachter mit juvenil schnellschüssigen Wirklichkeitsdiagnosen glücklicherweise vollkommen verschonen; Regisseure wie Bednárik oder Herrmann und Herrmann erzeugen in Bann schlagende Gegenwelten, Gegen-Welten, die auch dem Schrecken der heutigen sozialen Wirklichkeit Prags künstlerisch antworten.
Ja, und die Musik? Das Sprichwort, nach dem die Musik das Herz der Böhmen sei, lässt sich im Zeitalter des allerorts plärrenden, universal gewordenen Stuss-Radio-Gedudels sicher nicht mehr einfach nachsprechen. Nichtsdestotrotz kennzeichnet die Prager Orchester am Nationaltheater und der Staatsoper eine spezifische Mischung aus Musizierlust und Akademismus, die sie von anderen unterscheidet. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob jemand die Solo-Violine zur Gilda-Arie so doppelbödig und gleichzeitig liebevoll spielen kann wie im Graben der Staatsoper, oder ob der Harfen- oder Holzbläserpart zur Rusalka in derlei elektrisierender Weise überhaupt irgendwo so authentisch, eben wie aus den sternspiegelnden böhmischen Seen selber, erklingen kann oder ob Mozart in Wien oder Salzburg wirklich mit soviel Verve und Witz rüberkommt wie im Ständetheater, scheint mir ebenso höchstfraglich. Auch überzeugen die teilweise den Werken zusätzlich einmontierten Geräusche allenthalben. Manchmal schleift der Ton, wohl insgesamt doch bei landfremden mehr als bei böhmischen, oder böhmisch empfundenen Komponisten. Mit dem Mähren Janacek jedenfalls, das war auf dem 125. Saison-Eröffnungskonzert zu hören, hat das Nationaltheaterorchester immer noch genauso Probleme wie vor gut 80 Jahren beschrieben, während für deutsche Bühnen unsichtbare Komponisten wie Zdenek Fibich oder Otmar Mácha hier in singulärem Glanz und in absolutem Format erstrahlen.
Die tschechische Nationaloper spielt gemeinsam mit dem Ständetheater künstlerisch eindeutig auf allerhöchstem europäischen Niveau, was angesichts des sich abzeichnenden Niedergangs des ehemaligen Opernlandes Italiens eine echte Hoffnung birgt, während die Staatsoper sich (wie übrigens in Deutschland auch oftmals) als austauschbar, beliebig, ohne ein erkennbar spezifisches Profil präsentiert. Allerorts ein Problem sind die Preise. Der Zutritt zu allen drei Opernhäusern ist für tschechische Verhältnisse ziemlich hoch. Wünschenswert wäre da eine staatlich satte Unterstützung des Nationaltheaters (aus dem Bildungsetat), um auf Dauer eine Art „Wanderoper“ etablieren zu können, die ärmere Schichten in Trabantenstädten genauso erreichte wie böhmische Dörfler. All das, damit der Traum der Böhmen und das Urversprechen ihrer Hauptstadt den Tschechen wenigstens auf der Bühne lebendig bleibt. Denn in der Musik wie in der Oper, zumal der tschechischen, kehrt Libusě’s Vernunft und Schönheit regelmäßig wieder.
|
Wolfgang Hoops - red / 22. Oktober 2007
ID 3490
Weitere Infos siehe auch:
|
|
|
Anzeigen:

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
CD / DVD
INTERVIEWS
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
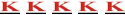
= nicht zu toppen
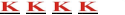
= schon gut
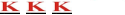
= geht so

= na ja

= katastrophal
|