Quark
bleibt
Quark
|

Die Frau ohne Schatten an der Staatsoper im Schiller Theater | Foto (C) Hans Jörg Michel
|
Szenische Bewertung: 
Die Frau ohne Schatten ist nicht gerade ein einfaches Stück. Mit dem Ziel, eine humanistische Märchenoper, wie die Autoren glaubten, dass Die Zauberflöte von Schikaneder und Mozart eine sei, zu schaffen, geriet bereits Hofmannsthal die poetische Fabeldichtung so befrachtet mit Symbolen und Verästelungen, dass dann die gigantische Klangwelt von Strauss ihr Übriges tat, Leichtigkeit und Klarheit zu überwuchern. Schließlich mahnte das Ergebnis ihrer (nicht problemlosen) Gemeinschaftsarbeit aus der Zeit des Ersten Weltkrieges eher an Wagners Götterdämmerung oder Goethes Faust als an die Volksoper des Wiener Rokoko. Dennoch vermochte sich „Fr-o-Sch“, nicht zuletzt dank des Einsatzes von Künstlern wie Karl Böhm, Georg Solti und Herbert von Karajan, an den großen Häusern der Welt (und in den Plattenkatalogen!) durchzusetzen. So sind Aufführungen zwar schon wegen des enormen Aufwandes selten, doch umso höher die Erwartungen – bzw. die Enttäuschungen tief. Fragwürdig bleibt immer die verquaste Philosophie dieser Oper, in der „Menschlichkeit“ (der Schatten) für die Frauen alternativlos mit dem Gebärenkönnen und -wollen verbunden ist, weshalb z.B. Ruth Berghaus zu recht das Werk konsequent ablehnte.
Allerdings enthält die Fabel im Kern auch ein Hauptmotiv der Operngeschichte: Selbstüberwindung macht Liebe, und Liebe macht sehend. Ihre Menschwerdung erringt die Kaiserin schließlich durch Wahrnehmung anderer, Arbeitender, Niedriggestellter, auf deren Unglück sie als Privilegierte ihr privates Glück nicht gründen will. Das bleibt brisant. So gelang im Bühnenbild von Wilfried Werz, mit Kostümen Karin Strombergs und unter dem Dirigat von Otmar Suitner an der Staatsoper Berlin/DDR zuletzt dem Regisseur Harry Kupfer vor genau 46 Jahren vielleicht seine glücklichste und beste Inszenierung überhaupt (Premiere am 21.03.1971), deren vital einleuchtende und berührende Bühnenwirksamkeit diese Produktion bis in die Neunziger Jahre im Spielplan hielt – zweifellos, weil sie sich auf den humanistisch tendierten Sinn der Vorgänge konzentrierte, ihrer Poesie vertraute und dabei dem Phantastischen nichts schuldig blieb (ganz ohne überflüssige Aktualisierungen). Dass Liebe etwas zu Lernendes ist und eine Leistung, wurde spürbar – und durchaus erschütternd. Schreiber dieses muss hier unweigerlich und dankbar einige der großartigsten Opernabende seines Lebens erinnern, vor allem mit der legendären Ludmila Dvořaková als Färbersfrau und Enriquèta Tarres in der Titelpartie…
*
Hundert Jahre nach Abschluss der Partitur (die Uraufführung konnte erst nach dem Krieg, 1919, stattfinden, und zwar in Wien; Berlin folgte bereits 1920!) steht Die Frau ohne Schatten nun wieder in einer Neuproduktion auf dem Spielplan der Berliner Staatsoper – aber nicht auf ihrer Bühne, sondern der des Schillertheaters, dirigiert von keinem Geringeren als Zubin Metha. Allein wegen ihm wäre der Besuch dieser Aufführung verlockend und interessant. Und in der Tat erfährt die Mammutpartitur in ihrer Zerklüftetheit und vielgestaltigen Komplexität einen energischen Zugriff, der alles klar herausarbeitet, straff führt und besonders den leiseren Stellen Wärme verleiht. Nein, das Desaster hat weder Metha zu verantworten noch die exzellente Staatskapelle: sondern es ist und bleibt schlechterdings eine klangliche Katastrophe, das „Fr-o-Sch“-Orchester in der Schillertheater-Box aufspielen zu lassen, ein akustischer Ananchronismus der provinziellsten Art, wo die monumentalen Klangkaskaden der Zwischenspiele und des III. Aktes keine Chance haben. Wer Musik liebt und gar die von Richard Strauss, findet diese Zumutung unerträglich. Nur Verzweiflung mag der Grund sein, wenn man den Maestro da nicht hat absagen lassen können oder das Ganze weiter verschieben. Musikalisch und künstlerisch ist ein solches Werk in diesem Haus keinesfalls zu verantworten. Man veranstaltet ja auch keine Olympiaeröffnung im städtischen Schwimmbad.
Obendrein erweist sich die szenische Umsetzung als alles andere denn neu, sondern sie ist seit fünf Jahren der Opernwelt nur allzu gut bekannt, da Claus Guth & Team ihre Deutung schon in Mailand vorstellten, die, aus eins mach drei, als Koproduktion dann 2014 in London gezeigt wurde – und jetzt in Berlin. Selbst auf Youtube ist sie zu finden. Doch, mit Goethe zu reden, auch breitgetretener Quark bleibt Quark. Wir kommen an den Punkt, wo festzustellen ist, dass der „europäische Geist“ in diesen Hundert Jahren offensichtlich nicht nur nichts hinzugelernt hat, sondern das, was er indessen hervorbrachte, so weit vergisst, dass er sich selbst vergessen hat. Nicht nur ist eine Oper kein Musical – und schon gar nicht im 21.Jahrhundert. Sie ist auch so wenig bloß ein „Produkt“, wie ein Opernhaus ein Warenhaus ist, nicht mal im Berliner Schillertheater.
Also Claus Guth oder seine Dramaturgin stellen fest, dass Märchen und Träume nichts miteinander zu tun haben und erklären die Frau ohne Schatten als Halluzination einer hysterischen Frau im Wien Siegmund Freuds. Originell ist das mitnichten, leider folgt daraus, dass man stundenlang auf die hässlich dunkelbraunen Holztapeten-Wände eines hässlichen Krankensaales blickt und darin eine an Plattheit, Kitsch und Geistlosigkeit kaum zu unterbietende Szenerie. Nach wenigen Minuten schon fährt die Amme, bestückt mit schwarzen Plastik-Teufelsflügelchen (aus dem Faschingssortiment), ins Scheinwerferlicht, von vornherein überdeutlich festgenagelt auf „die Böse“ – und so dann alle „bösen“ Gestalten des Stücks, deren Spielastik sich etwa auf dem Niveau von C-Picture-Vampyr-Movies, hämisch grinsend und wippend, bewegt. Dass da die atemberaubende Tragik der Amme, ihre Zärtlichkeiten und Illusionen gleich miterledigt sind, wegen denen sie doch eine gehörige Menge Dinge veranstaltet, fällt wohl schon niemand mehr auf – aber es raubt der Sängerin manch Farbe und Facette für die Gestaltung ihrer Partie!
|

Die Frau ohne Schatten an der Staatsoper Berlin | Foto (C) Hans Jörg Michel
|
Die „Traumfiguren“ stecken natürlich in gnadenlos exakten Kostümen der Zeit, sie haben gnadenlos naturalistische Tierköpfe aufgesteckt und bewegen sich meist irgendwie gnadenlos „tänzerisch“ und „anmutig“ (die Idee des Dichters, den Falken des Kaisers auftreten und singen zu lassen, hat offenbar niemand verstanden: ein Falke ist sicherlich kein Vögelchen, wie es vielleicht in der Kindertanzgruppe à la Peter und der Wolf gespielt wird). Es löst nicht die geringsten Assoziationen aus, mit Träumen hat es so wenig zu tun wie mit der Kunst der Surrealisten oder irgendeiner Art von Witz (es ist seit Kupfers Bayreuther Holländer ein dermaßen abgegriffenes Theatermittel, dass sogar erst in der letzten Staatsopern-Premiere die Geschichte vom King Arthur als Fiebertraum des kleinen Jungen erzählt wurde – allerdings voller Spielphantasie und Poesie). Und ja, mit welcher Waffe muss der Kaiser anfangs zur Jagd gehen? Genau, mit der er auch zur Kaiserin ins Bett stößt, einem langen, langen Speer…
Indem von vornherein das gesamte Geschehen nur als Erzeugnis „kranker“ Einbildungen eingeführt wird, kann es, darüber hinaus, weder übergreifend berührende Bedeutung noch Erkenntnis auslösen (als die Färberin verkündet, hier nicht länger bleiben zu können, ist das natürlich kein selbstbewusstes Aufbegehren mehr, sondern nur noch lächerlich, da sie ja ebenfalls als Geisteskranke festgehalten wird). Es bleibt der Konflikt ein eingebildeter – die Kämpferin steht mit ihrer Wahnidee allein im Ring. Das also passiert, wenn Opernprofessionelle heutigentags die Akte eines Psychoanalytikers von 1908 lesen, von der sich der Librettist allerdings für die Figur eines Kunstmärchens inspirieren ließ! Die Anlässe einer „mentalen Depression“, ihre Bedingungen bleiben außer acht, wie alle gesellschaftlichen Dimensionen. Ganz zu schweigen von denen des eigentlichen Werks, etwa das Gefälle zwischen Geisterwelt, Kaiserhöhe und der Färbersebene, deren bedeutungsvolle Abstände im Märchen präsent sind, bei Guth & Co. aber für die Illustration von „Pathologie“ negiert werden.
Dabei entgeht der Regie eine Grundfrage ihres eignen Spielprinzips: hat diese „Kranke“ denn gar kein Genie, da ihrem Innern nicht nur die hochsinnigen Verse Hofmannsthals, sondern diese offenbar universale Musikflut vom Format eines Richard Strauss entspringen, die sie gliedernd zu meistern vermag? Sie müsste doch als Dichter-Komponistin einen Ausweg finden, „kreativ“ zu wirken in ihrer Welt? Auszubrechen zum Beispiel aus der patriarchalen Denunziation von Frauen (die auch diese Regie unkritisch fortwebt und ausschlachtet), oder nicht minder aus dem im Hintergrund tobenden Weltkrieg – apropos (männliche) Traumdeutung und historischer Zeitbezug? Der Verlust des Wertegefühls (sic!) bei mentaler Depression (Titel des im Programmheft zitierten Fallbeispiels) wäre somit auch der Inszenierung in ihrer Verflachung zu attestieren. Nein, es bleibt alles ohne Einsicht, ohne Zauber, ohne Zusammenhänge, ohne Tiefe, die Inszenierung gewinnt keine Menschlichkeit, keine Seele, keine Realistik und Transparenz, und das umso mehr, je verbohrter von „Psychologie“ die Rede geht: und die Darsteller „Emotion“ spielen – „gefühlvolle“ Gesten und „aufgeregte“ Blicke, unglaubwürdig, austauschbar, oberflächlich.
|

Michaela Schuster als Amme in Die Frau ohne Schatten an der Staatsoper Berlin | Foto (C) Hans Jörg Michel
|
„Übermächte sind im Spiel“ heißt es im II. Akt, aber wo etwa die Magie der Amme ins Spiel kommt, werden 1:1-Videoprojektionen an den Hintergrund geworfen, deren Geschmacklosigkeit sofort jeden Gedanken lähmt: gefilmte Fischlein mit hineingeblendeten drei Köpfen von Embryonen zerstören die letzte dichterische Metapher. Ja, der Kaiser geht zur Jagd, und der Färber hat seine Hände in stinkender Arbeit – Kurzschluss: tote Tierattrappen fallen blutig angemalt ins Schlafzimmer und werden ausgeweidet. Dramatisch wirkt das so wenig wie sinnerhellend, nur banal. Die Erscheinung des Jünglings entlarvt in nuce das Ganze: wo die unterbewussten Triebe und Lüste sich verkörpern (und wäre das etwa kein Traummotiv, so, wie ja alle Kunst, fast märchenartig, mit Traummotivik operiert?): Da spaziert aus dem Hintergrund ein mittelmäßiger junger Mann in weißem Anzug mit schwarzem Schnurrbärtchen und glattgekämmtem Haar und singt plötzlich lautstark ins Publikum. So erregend wie die Ansage einer Umbesetzung. Soll das etwa der junge Herr von Hofmannsthal sein, oder was? Und es soll die erotischen Sehnsüchte einer jungen, leidenschaftlichen Frau verkörpern? Geht’s noch spießiger? Wo wird da was aufgedeckt, wo etwas sinnfällig und gezeigt, dass man zuvor nicht sah? Tautologien allerwege, Klischees, einfallslos wie ein Industriefilm.
Und damit all dieses Eineindeutige auch noch ganz unmissverständlich erklärt wird, ist das Programmheft voller Selbstkommentare und Zitate der Spielleitung. Keine Geheimnisse, keine Rätsel, keine Widersprüche. Die Widersprüche zu Text und Sinn der Partitur werden schon in der Inhaltsangabe geglättet, wo die Handlung der Regie und nicht die des Librettos resümiert wird (der Begriff Liebe kommt nicht vor, wohl aber der der Schuld). Was nicht passt, wird passend gemacht – und so das Publikum imgrunde um Werk und Kunsterfahrung betrogen. Mehr ist für das Konsumieren eines Produkts gehobener Unterhaltung in Zeiten ideologischen Rollbacks auch nicht notwendig: um den (auswechselbaren) Warencharakter des Gebotenen zu garantieren, werden die Besucher aller Mitarbeit, aller Selbstbeteiligung und geistigen Herausforderung enthoben. Die „Zuschaukunst“ als Bestandteil des Theatervorgangs ist, wie die dazugehörige Literatur, längst entsorgt. Hier ist die Abteilung für Klassische Musik. Sie werden bedient. Sie brauchen nichts weiter zu tun. Sie zahlen, wir spielen, sie applaudieren. Völlig belanglos. Kultur im Ausverkauf, Festivalpakete mit Wohlfühl-Angebot.
Auf kulturradio wurde die Aufführung live übertragen. Optisch gesehen war dessen Zuhörerschaft insofern durchaus zu beneiden – sie musste nicht die Szenerie mit ertragen. Andererseits, gezwungen nur das Akustische wahrzunehmen, war das beneidenswert? Haben die Rundfunkkollegen den Klang räumlich aufgehallt? Vielleicht konnten sie mit ihrer Technik etwas nachhelfen, aber was die Gesangsleistungen betrifft, sind ihren Möglichkeiten so Grenzen gesetzt, wie jenen. Verwechselbar klangen nämlich auch die Stimmen, zumindest die der Soprane. Charakteristische Timbres und Gesangspersönlichkeiten sind rar geworden, die Schulen fördern offenbar Austauschbarkeit und Angleichung, vielleicht ist das dem Markt geschuldet, der „Eigenartigkeiten“ und dem Besonderen hinderlich wird? So klang der Falke wie die Kaiserin, und dann auch irgendwie die Färbersfrau wie die Kaiserin (im Piano jedoch sangen beide nebeneinandersitzend auf ihrem Krankenbett eine schöne Passage, umwoben vom Violinsolo); alle wetteifernd im Vibrato. Da hatte das Theaterpublikum wieder den Vorteil der Textprojektion, weil: viel Vibrato, wenig Verständlichkeit. Für die Radiozuhörer dürfte es schwierig gewesen sein, durch das Gegurgel etwas von den Worten zu verstehen. Wenn dazu die Chorsoprane schrillen, wird man müde, dem Ganzen länger zuzuhören.
* *
Immerhin die Amme (Michaela Schuster) sang die exorbitante Partie relativ textverständlich und vermochte mit Ausdruckskraft zu überzeugen, wenngleich in der Tiefe ans Sprechen grenzend. So auch tönte der Kaiser bis in die Höhen zwar passabel, gleichwohl eng und wenig glanzvoll. Allein der Barak des überragenden Wolfgang Koch beeindruckte von neuem (wie schon als Wotan in Bayreuth): sowohl gesanglich als auch darstellerisch. Er gab mit seinem substanzvollen, schön geführten Bassbariton ein ganzundgar adäquates Rollenporträt von großer Gewichtung und einfühlsamer Tiefe. - Nur ist Die Frau ohne Schatten auch eine Oper der Soprane – doch wenn die obendrein unwillkürlich mit Sängergesten hantieren, als sei das eben so in der Oper, hört bei Schreiber dieses in einer Berliner Staatsoper, an der mal die Berghaus und Kupfer wirkten, jedes weitere Interesse abrupt auf – und hier der Text.
|

Die Frau ohne Schatten an der Staatsoper im Schiller Theater | Foto (C) Hans Jörg Michel
|
Uwe Schwentzig - 10. April 2017
ID 9961
DIE FRAU OHNE SCHATTEN (Staatsoper im Schiller Theater, 09.04.2017)
Musikalische Leitung: Zubin Mehta
Inszenierung: Claus Guth
Szenische Einstudierung: Julia Burbach
Bühnenbild / Kostüme: Christian Schmidt
Licht: Olaf Winter
Video: Andi A. Müller
Chor: Martin Wright
Dramaturgie: Ronny Dietrich
Besetzung:
Der Kaiser ... Burkhard Fritz
Die Kaiserin ... Camilla Nylund
Die Amme ... Michaela Schuster
Der Geisterbote ... Roman Trekel
Barak ... Wolfgang Koch
Baraks Frau ... Iréne Theorin
Ein Hüter der Schwelle des Tempels ... Evelin Novak
Erscheinung eines Jünglings ... Jun-Sang Han
Die Stimme des Falken ... Narine Yeghiyan
Die Stimme von oben ... Anja Schlosser
Der Bucklige ... Karl-Michael Ebner
Der Einäugige ... Alfredo Daza
Der Einarmige ... Grigory Shkarupa
Dienerinnen: Sónia Grané, Evelin Novak und Natalia Skrycka
u.v.a.
Premiere im Teatro alla Scala Milano war am 11. März 2012
Berliner Premiere: 9. April 2017
Weitere Termine: 13. + 16.04.2017
Eine Koproduktion des Teatro alla Scala di Milano und des Royal Opera House Covent Garden London
Weitere Infos siehe auch: http://www.staatsoper-berlin.de
Post an Uwe Schwentzig
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unterstützen auch Sie KULTURA-EXTRA!

Vielen Dank.
|
|
|
Anzeigen:

Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
CD / DVD
INTERVIEWS
KONZERTKRITIKEN
LEUTE
NEUE MUSIK
PREMIERENKRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
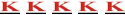
= nicht zu toppen
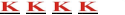
= schon gut
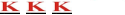
= geht so

= na ja

= katastrophal
|