26. Februar 2014 - English Theatre Berlin
SCHWARZ GEMACHT
Written by Alexander Thomas / directed by Daniel Brunet
|

Schwarz gemacht am English Theatre Berlin | Bildquelle (C) http://www.etberlin.de
|
„Es ging spazieren vor dem Tor / ein kohlpechrabenschwarzer Mohr…“ beginnt Klaus (Ernest Allan Hausmann) seinen Vortrag des Gedichts Die Geschichte von den schwarzen Buben von Heinrich Hoffmann. Die Zeilen entringen manchem Zuschauer ein vorsichtiges Lachen. Klaus ist kein deutscher Bub wie aus dem Bilderbuch, weil er dunkelhäutig ist; und überhaupt ist er gar kein Bub, sondern ein Mann Mitte dreißig. Spätestens wenn auf der Leinwand hinter der wandlosen Bühne das Datum eingeblendet wird – wir befinden uns im Deutschland der Dreißiger - , ist zu bezweifeln, ob Klaus' Geschichte so glimpflich ausgeht wie die des Mohrs im Gedicht, dessen Spötter ein unfreiwilliges Tintenbad nehmen.
Die Produktion Schwarz gemacht, am English Theatre Berlin unter der Regie von Daniel Brunet und der dramaturgischen Leitung von Aline Benecke entstanden, hat eine lange Geschichte. Zunächst als 10-Minuten-Monolog konzipiert, baute der New Yorker Dramatiker Alexander Thomas seinen Text über die Jahre weiter aus; 2006 fand im Rahmen der Reihe "Colorblind?" eine längere szenische Lesung statt - da lautete der Titel noch Others Within. Die afrikanisch-deutsche Geschichte ließ den Autor nicht los, der jahrelang zu dem Thema recherchierte und sich dabei als Afroamerikaner immerfort die Frage stellte, wo die Entfremdung von der eigenen Identität als Schwarzer in den 30er und 40er Jahren wohl größer war: in den USA? Oder etwa doch in Deutschland?
Es ist ein Koloss von einem Geschichtskapitel, das da aufgeschlagen wird; das zeigen schon die Infotafeln im Foyer des English Theatre, vor denen sich das zahlreich erschienene Publikum vor der Aufführung und in der Pause drängt, um etwas über die jüngere deutsch-afrikanische Geschichte zu lernen. Die Köder sind ausgeworfen, man ist gespannt auf eine Inszenierung, die immerhin schon mal nicht mit pädagogischem Nährwert zu geizen scheint.
Berlin 1938: Pensionsleiterin Ruth (Kerstin Schweers) und Filmemacher Glockner (Marco Klammer) drucksen herum, als sie Neuankömmling Lisa (Miriam Anna Schroetter), einer amerikanischen Diplomatentochter auf der Suche nach ihren deutschen Wurzeln, von ihrem Bediensteten erzählen. Wie erklären, dass Klaus schwarz und zugleich stolzer Deutscher ist, nicht weniger deutsch als sie selbst? Dem ernsten Mann, der Lisa die Koffer aufs Zimmer trägt, begegnet die junge Frau mit einer Mischung aus Verwunderung und Faszination; kommt sie doch aus dem Land, in dem Rassentrennung an der Tagesordnung und schwarzer Patriotismus eine Seltenheit ist.
Schroetters Lisa ist in ihrer grundnaiven Begeisterung für Deutschland ein so präzise skizzierter Charakter, wie es auch Ruth und Glockner in ihrer Wishy-Washy-Ambivalenz sind. Nur: Furchtbar viel Weiterentwicklung darf man von ihnen in den kommenden zwei Stunden nicht mehr erwarten. Die Bewohner der Pension bewegen sich bei ihren Auftritten praktisch nicht aus den Winkeln heraus, in die sie die Regie aus unerfindlichen Gründen platziert hat; auf die vier Ecken der quadratischen Bühne verteilt sind sie auch durch einzelne Lichtspots voneinander isoliert. Vielleicht soll diese Distanziertheit etwas typisch Deutsches suggerieren, wie etwa auch die etwas hölzerne Art, die spießig-graue Kleidung, oder der dicke Akzent, den der so fremd aussehende Klaus mit den weißen Deutschen gemein hat. Man weiß nicht so recht, was mit dieser Konstellation versucht werden sollte, man weiß nur: Der Versuch geht nach hinten los. Leicht diffuse, linkische Gespräche über die Reichsbürgergesetze, Klaus' Engagement als Darsteller in NS-Kolonialfilmen und die Gefahr durch die Nazis werden in ewig gleiche Standbilder gepackt und ermüden eher, als dass sie aufrütteln. Auflockerung erfährt das Ganze zunächst nur in den einsamen Momenten, in denen Klaus den Geist seiner Mutter zu ihm sprechen hört - oder Zeitungshaufen durchwühlt, um sich über den aktuellen Stand der Rassengesetze zu informieren.
Nahtlos reihen sich Szenen in der Pension an Szenen im Untergrund - einem Club, der mit seiner „entarteten“ Jazzmusik offiziell nicht genehmigt ist. Klaus wird von diesem Jazzkeller angezogen, als sei es sei eigenes schlummerndes Unterbewusstes; die Begegnung mit dem Schwarzen Maurice wird zu einem Aufeinandertreffen zweier sehr ungleicher Leidensgenossen.
Echte Lichtblicke in der gleichgeschaltet-grauen Welt des Stücks sind diese Untergrund-Szenen, insbesondere dank Sadiq Bey als Maurice, der glatt einem Spike Lee-Film entstiegen sein könnte. Seine Rolle als nonchalanter afroamerikanischer Jazzmusiker ist Bey wie auf den Leib geschrieben; vor allem aber ist er als hep cat (Urahne des heutigen Hipsters) ein gelungener Gegenentwurf zu Klaus, seinem schwarzen „Bruder“, dem Komplimente zu seiner allzu vaterländischen Montur auch noch schmeicheln. Das Gespräch zwischen den beiden nimmt nur langsam an Fahrt auf, entwickelt sich dann aber zu einem verbalen Match, das US-amerikanische und deutsche schwarze Identität aufeinander prallen lässt, und aus dem weder Afroamerikaner noch Afrodeutscher siegreich hervorgehen.
Regisseur Daniel Brunet wolle Klaus' inneren Konflikt forcieren, indem er "den illegalen Jazzclub und die Pensionswelt flüssig ineinander übergehen" lässt, sagt er im Gespräch mit tip Berlin. Das funktioniert insofern, als Hausmann/Klaus im Jazzkeller, konfrontiert mit seinem dunkelhäutigen „Spiegelbild“ - wie Maurice ihn nennt - seine stärksten Auftritte hat. In dem Moment etwa, wo er Maurice ein Zeitungsfoto unter die Nase hält, auf dem ein jüdischer Immigrant zu sehen ist, der zur Solidarität mit den verfolgten Juden in Nazi-Deutschland aufruft. Im Hintergrund hängen gelynchte Schwarze an den Bäumen. Erstmals kommt Dynamik in die Inszenierung, wenn Klaus schattenboxend den Kampf zwischen Max Schmeling und Joe Louis nachstellt. Maurice hat nur ein Kopfschütteln für den jungen Mann übrig, der mit seinem weißen Landsmann mitfiebert.
Dramaturgisch rudert man immer so ein bisschen an Zuspitzungen vorbei; wirkliche Überraschungen gibt es keine. Das Anbändeln zwischen Klaus und Lisa endet ebenso abrupt wie die Szene, in der eine Konfrontation des Nachtwanderers Klaus mit der Patrouille angedeutet wird. Da ist bereits nach dem ersten Akt die Luft raus, alles Konfliktpotential verpufft, alles zigmal wiederholt worden. Klaus' Zerrissenheit kann nachempfunden werden, auch ohne dass dieser gen Auditorium brüllt: „Ich bin Deutscher!“ Irgendwie scheint man dem Publikum nicht unbedingt das nötige Gespür für Zwischentöne zuzutrauen.
Der Name des berühmten Kolonialfilm-Darstellers Louis Brody mag häufig fallen; Erkenntnisse über das Schauspieler-Dasein Afrodeutscher zur NS-Zeit bleiben aber aus. Eines der Hauptthemen, unter denen Schwarz gemacht eigentlich angekündet war, kommt also deutlich zu kurz – sieht man einmal von einem kunstvollen Video-Einspieler ab, der eine kurze Szene aus einem expressionistischen Stummfilm zeigt. Da finden sich dann auch Insider-Querverweise auf die Blackfacing–Debatte, die Anlass zur oben genannten Colorblind?-Reihe gab.
Fazit: Viel history, wenig story. Halbgare Charaktere hangeln sich durch ein gut recherchiertes, aber farbloses Stück, in dem es mehr um Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland geht als um eine innerdeutsche Perspektive. Schade, dass dieses viel zu wenig beachtete Thema in eine wenig inspirierte Lehrstunde verpackt wurde.
|

Schwarz gemacht mit Kerstin Schweers (als Ruth) und Ernest Allan Hausmann (als Klaus) - Foto (C) Daniel Gentelev
|
Bewertung: 
|
Jaleh Ojan - 5. März 2014
ID 7648
SCHWARZ GEMACHT (English Theatre Berlin, 26.02.2014)
Regie: Daniel Brunet
Dramaturgie: Aline Benecke
Bühne: David L. Arsenault
Licht: Christian Maith
Kostüme: Tamar Ginati
Musik: Natalia Lincoln
Video: Noam Gorbat
Mit: Sadiq Bey, Ernest Allan Hausmann, Marco Klammer, Miriam Anna Schroetter und Kerstin Schweers
Premiere war am 26. Februar 2014
Weitere Termine: 5., 6., 7., 8., 12., 13., 14., 15. 3. 2014
Weitere Infos siehe auch: http://www.etberlin.de
Post an Jaleh Ojan
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
THEATERTREFFEN
URAUFFÜHRUNGEN
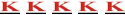
= nicht zu toppen
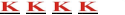
= schon gut
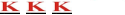
= geht so

= na ja

= katastrophal
|