Luce Ovide und Tobias Schwartz lesen im Berliner Theater unterm Dach
|

Das ist Tobias Schwartz | Bildquelle (C) http://www.tobias-schwartz.de
|
Der Traum des Übersetzers
Er übersetzt Groschenromane für das Kleingeld zum Überleben. Die Scheine für das Vergnügen nimmt er aus der Kasse seiner Phantasie. Lieber würde er Virginia Woolf ins Deutsche so bringen wie vor ihm keiner. So kongenial. Das ist der Traum des Übersetzers. Er fühlt sich erhaben in seiner Vorhölle.
Allmählich kommt er der Realität abhanden. Protagonisten des ernährenden Schunds helfen bei der Fiktionalisierung seiner Existenz. Ritter im Dekor ihrer Hochzeit feiern Orgien in der Gegenwart ihres Übersetzers. Sie reiten auf und kehren ein, wo immer der Namenlose gerade verblasst. Tobias Schwartz hat ihn sich ausgedacht als Helden seines (unveröffentlichten) Romans Stadt unter. Im Theater unterm Dach liest auch die Schauspielerin Melanie Straub daraus vor.
Manche Textbilder narkotisieren den Zuhörer. Die Intensität kommt jedenfalls nicht aus der Sprache, da ist vieles ambitioniert. Tatsächlich wirkt sich der Erzähleinfall so aus, dass er sich einnistet. Man kann sich das gut vorstellen: Ein junger Mann, mit mehr Ehrgeiz als Verstand, übersetzt Liebesschmalz, Erotik und Pornografie, jedes Genre befolgt eigene Gesetze aufs Wort. Zwangsläufig ergibt sich ein Hypertext, den Schwartz an – wie im Überflug gewonnene oder aus einer Kehrmaschine herausgeschossene – megastädtische Ansichten knüpft. Alles triftet „in Richtung Nacht“. Registriert werden „zerfallene Gesichter“, „scheußliche Uhren“, verwirrte Verkehrsteilnehmer, kollabierende Konsumenten, stechende Gerüche, streikende Haut und Pressfleisch, das fallengelassen wurde. Teer siedet. Schatten haben Schwänze. Ich sehe den Prospekt schwarzweiß, obwohl Farben im Register stehen. Der Autor gibt seine Referenzen an: Manhattan Transfer, Paare Passanten, „ein Nagel verfolgt den Lauf der Zeit“.
Für Schwartz zählt, mit welchem Fuß einer in Kotze tritt. Sein Namenloser lebt mit einem gewaltigen Ekel. Der Ekel zwingt ihn, das Ekelhafte zu benennen. Er ist Phobiker, ein steriler Charakter. „Die Blicke einer Frau sprechen Bände“, er möchte sie nicht lesen.
Unglückliche Frauen als leichte Beute für den Verlierer.
Stadt unter spielt mit Perspektiven. Eine Frau berichtet von einem Mann, es könnte die Rede vom Namenlosen sein. Sie schleppt ihn aus einer Kneipe ab, es geschieht das Angestrebte, nun trennt sie ihre Gefühle nach Sorten. Einerseits hat ihr der Mann gut getan, allein, dass er sie berührte. Andererseits fühlt sie sich „benutzt“ und von Lieblosigkeit denunziert. Es könnte sein, dass man dem namenlosen Übersetzer die Ambivalenz in den weiblichen Empfindungen gar nicht plausibel machen kann, so somnambul und surreal verläuft sein Leben an der Wirklichkeit einer Alleinerziehenden vorbei.
* * *
Tage wie diese
Das Licht ist gut. Luce Ovide misst einen Tag daran, wie er sich anschauen lässt mit empfindlichen Augen. Die Amerikanerin nennt sich und ihre Heldin Staatsbürgerin von „Nowhereisland“, einer Nation „in internationalen Gewässern“. Wohin dich die Füße tragen spielt gewiss nicht an auf „So weit die Füße tragen“, wahrscheinlich kennt man den Titel überhaupt nicht mehr. In der Ankündigung wird der Text als „Mediation“ beschrieben, er oszilliert zwischen vagen Landmarken, geht aber von einem konkreten Vorgang aus: Die nomadische Erzählerin kriegt von der Meldebehörde „eine Fiktionsbescheinigung“, die allerdings ihren Status nicht klärt. Deshalb wird sie Bürgerin von „Nowhereisland“, das ein bisschen an die Republik Christiania in Kopenhagen erinnert. Das schwingt in der Erzählung mit: dass totale Freiheit und überbordender Individualismus zum Kollaps jeder Gemeinschaft führen.
Ach so, auch Luce Ovides Heldin übersetzt, „das Flair eines Wortes“ spricht sie an. Jane Bowles ist eine Heilige in ihren Augen. Sie kennt grausame Monate, da fallen Katzen und Pflanzen auf einen falschen Frühling herein.
Die Grundstimmung bleibt frostig. Alles erscheint vorläufig. Die Übersetzerin macht einer Apothekerin einen Heiratsantrag, mit verstörender Wirkung. Sie glaubt: „Die Sprache entstand aus dem Verlangen zu täuschen, dem Wunsch, sich vor dem Fremden zu schützen.“
|
Jamal Tuschick - 7. Oktober 2013
ID 7229
Post an Jamal Tuschick
Zu den anderen AUTORENLESUNGEN
|
|
|
Anzeige:
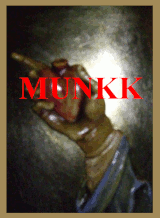
Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
AUTORENLESUNGEN
BUCHKRITIKEN
DEBATTEN
INTERVIEWS
KURZGESCHICHTEN-
WETTBEWERB [Archiv]
LESEN IM URLAUB
PORTRÄTS
Autoren, Bibliotheken, Verlage
UNSERE NEUE GESCHICHTE
Reihe von Helga Fitzner
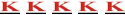
= nicht zu toppen
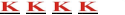
= schon gut
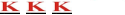
= geht so

= na ja

= katastrophal
|