Wirtschaftskunst und Kopiersysteme
|

Hubert Lepka
|
| Das Gespräch fand am 16. April in Sölden statt, dem Tag nach der letzten Aufführung von Hannibal. Verlauf einer Alpenquerung am Gletscher.
|
In derart großen Inszenierungen spielt immer das Risiko des Scheiterns mit. Gestern gab es (für das Publikum kaum merkliche) Probleme mit dem Hubschrauber. Sie haben das Risiko auch immer durchaus begrüßt als etwas Besonderes in Zeiten von soviel Perfektion am Theater. Wieviel ist denn aber in fünf Jahren Hannibal tatsächlich schief gegangen?
Wirklich eine Menge, denn das Stück ist sehr komplex gebaut. Wenn bei Raumschiff Enterprise einzelne Systeme ausfallen, dann geht das immer noch weiter. Hannibal ist ähnlich strukturiert, es ist so gebaut, ja geradezu darauf angelegt, dass einzelne Systeme ausfallen können. Das ist schon allein deshalb so, weil das Wetter wirkliche Schwierigkeiten bereiten kann, da muss man einzelne Teile abschalten können, um die Grundfunktion der Erzählung zu erhalten.
Das Stück muss sich an die Natur anpassen?
Wie bei Lebewesen auch. Damit sind wir bei den Körperfunktionen. In kritischen Situationen etwa, zum Beispiel wenn ein Mensch unter die Lawine kommt, schaltet der Körper bewusst unwichtigere Funktionen ab. Unterkühlte Menschen haben mehr Chance, unter der Lawine zu überleben, weil sie aufgrund abgeschalteter Gehirnfunktionen weniger Sauerstoff brauchen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber Performances, solche Stücke wie hier, sind Lebewesen, die sich einer Umwelt hier in den Bergen, aber auch einer narrativen Umwelt, einer Schnittstelle zum Zuschauer hin, anpassen. Wenn ein Stück die Möglichkeit hat, bestimmte Funktionen abschalten zu können und trotzdem weiter zu existieren, passt es eher in diese raue Umgebung, als ein Theaterstück, das nicht mehr funktioniert, wenn ein kleines Element ausfällt.
Sie haben großen Erfolg, gestern waren acht oder neuntausend Zuseher dabei. Gibt es auch negative Stimmen, insbesondere hier in Sölden und Umgebung?
Die hat es immer gegeben. Bei der einen Richtung, die mir noch am sympathischsten ist, die man sich aber trotzdem genauer anschauen muss, heißt es „Passt denn so ein Megaspektakel in die Alpen, wo doch Stille herrscht und Kontemplation?“ Doch das ist keineswegs ein Ort der Stille und Kontemplation, sondern eine Werkstätte der Tourismusindustrie, wo großer Massenumschlag passiert. Diese Tourismusindustrie existiert in den Alpen, was übrigens auch begrüßenswert ist, denn ansonsten müssten wir Chemiefabriken bauen oder Papier herstellen. Da empfinde ich es noch als eine relativ sympathische Art der Erwerbstätigkeit, anderen Menschen einen schönen Ort zu zeigen.
In Ihren Werken spielt der vertikale Raum immer eine große Rolle. Man fragt sich, was treibt den Choreographen Hubert Lepka in die Lüfte. Sind Sie als Kind der Alpen schon von Geburt an damit verbunden?
Das ist sicherlich richtig. Ich bin in den Bergen aufgewachsen und sie spielen auch analytisch gesehen eine wichtige Rolle. Das ist sozusagen die Vaterfigur, es gibt eine analytische Rückbindung an das Geschlechterpaar Vater und Mutter und das setzt sich in der Landschaft fort. Man hat eine elterliche Beziehung zu gewissen Landschaftsformen. Auch wenn man den Begriff Heimat heute nicht so gern hat, fühlt sich jeder zu gewissen Landschafts- oder Existenzformen vom Aufwachsen her hingezogen und bei mir spielen die Berge hier schon eine große Rolle.
Sind mit einem Großprojekt, wie es Hannibal ist, schon räumliche und personelle Grenzen abgesteckt oder könnten Sie sich vorstellen auf noch größerem Raum und mit noch mehr Menschen zu arbeiten?
Grundsätzlich ist die Art von Theater oder Choreographie, die wir machen, nicht an eine bestimmte Größenordnung gebunden. Ich sehe aber keinen besonderen Wert darin, es immer größer zu machen. Es gibt für einen bestimmten Raum eine bestimmte Größe und eine Besetzung. Das können Maschinen sein, können Menschen sein. Ich glaube, grundsätzlich sind wir aber hier an keine Grenze gestoßen.
Ein so hoher personeller und technischer Aufwand will auch finanziert werden, was Sie eng an große Unternehmen wie Red Bull oder Autokonzerne bindet. Wie schafft man es, dass von solchen Kooperationen beide Partner profitieren, sowohl Wirtschaft als auch Kunst mit ihren unterschiedlichen Interessen?
Ich kann nur in solchen Win-Win-Situationen arbeiten, weil wir uns irgendwann entschieden haben, nicht staatlich geförderte Kunst zu machen, sonder Wirtschaftskunst. Hier ist es keine Förderung, man braucht nicht erwarten, dass man von der Wirtschaft eine Förderung bekommt. Es ist ein Handelsgeschäft und dieses Handelsgeschäft hat wirtschaftliche Parameter. Das heißt aber nicht, dass es für die Kunst nicht lukrativ ist, denn wenn ein großes Unternehmen Aufmerksamkeit braucht, muss es Aufmerksamkeit herstellen können. Eine der wenigen Formen zur Erzeugung von Aufmerksamkeit ist Kunst. Wenn wir also lediglich die Aufgabe haben, Aufmerksamkeit zu erzeugen, sind wir bei der Kunst an der richtigen Adresse, denn sie kann das erstens und zweitens hat sie damit ein leeres Blatt bekommen. Wir bekommen also eine Art leeres Blatt in die Hand und können damit machen, was wir wollen. Man hat in dieser wirtschaftlichen Auftragskunst niemanden, der bestimmt, was die wirklichen Inhalte sind. Vielleicht bestimmt ein Autokonzern das Auto, er sagt, wir müssen das mit dem neuesten Modell machen. Welche Bewegungen ich aber damit vollführe und welche Idee ich dann wirklich umsetzte mit den Menschen, den Maschinen, den Möglichkeiten, die ich habe, das ist meine Sache. Da gibt es vom Prinzip her eine gute Möglichkeit einen Mehrweit für die Kunst zu erzielen. Es ist natürlich immer verdächtig, solche Kunst wirkt gekauft. Sie wirkt es aber nur, ich glaube nicht, dass wir käuflich sind.
Im Unterschied zu staatlich geförderter Kunst?
Staatlich geförderte Kunst ist genauso gekauft, denn sie muss das Geld vom Staat kriegen, wobei aber eine Inhaltskontrolle gegeben ist. Wie groß die ist, weiß jeder, der schon einmal ein Subventionsansuchen abgegeben hat, das über Seiten hinweg nichts anderes tut, als Inhalte zu beschreiben. In der Wirtschaftskunst findet lediglich eine Kontrolle der formalen Parameter der Aufmerksamkeitserzeugung statt.
Letztes Jahr haben Sie in einem Vortrag eine Art von sexueller Beziehung zwischen Wirtschaft und Kunst erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Sexuelle Beziehung im weiteren Sinne. Ich glaube, dass sich die Erde, das Weltall überhaupt, vor allem die humane Materie über sexuelle Muster fortpflanzt, sonst würde sie sich nicht so schnell fortpflanzen können. Diejenigen Ausleseprozesse, die nur über das survival of the fittest ablaufen, sind langsamer. Die kapitalistische Wirtschaft ist überhaupt eigentlich ein Modell der Exploitation unserer Sexualität. Wir suchen uns Waren aus und nehmen dabei einen Auswahlprozess vor. Dieser Auswahlprozess findet auf Basis unserer ästhetischen Sinne statt, die ursprünglich dazu da sind, eine richtige Partnerwahl zu treffen, und nicht um die richtigen Waren auszusuchen. Das heißt, die kapitalistische Wirtschaftsweise hat sich unserer ästhetischen Sinne bemächtigt und nützt sie, um ein eigenes Leben zu führen. Damit sind wir auch an der Schnittstelle, warum Maschinen oder Fabriken lebendige Wesen sind, genauso wie Bäume lebendige Wesen sind, die Früchte hervorbringen und die Bienen attrahieren.
Haben Sie auf diesem Gebiet Vordenker, Ideen die Sie weiterverfolgt haben? Woher kommt der theoretische Bodensatz Ihrer Kunst?
Ich bin Darwinist. Darwin hatte eine geniale Idee, die sehr vieles erklärt. In der Jetztzeit gibt es eine neobiologistische Strömung, manches davon ist auch nicht so sympathisch, manches aber sehr. Und zwar genau das, was in Richtung Erklärung unserer Gedankenwelt geht, man nennt das Memetik. Die Memetiker sagen, dass wir kopieren, wir keine eigenen Gedanken haben. Damit sind Gedanken genauso als Lebewesen zu betrachten wie Pflanzen oder Tiere, womit wir bei der Kunst sind. Ich glaube nämlich, dass die Kunst ein Kopiersystem ist. So wie auch eine sonstige natürlich Flora, ein See, wo sich Lurche fortpflanzen, ein Kopiersystem ist, können sich im Kunstbetrieb Ideen oder Modelle fortpflanzen. Nur als besser oder schlechter.
Welchen Stellenwert nimmt Hannibal rückblickend in Ihrem Werk ein?
Hannibal stellt eine Markierung dar, weil es die erste große narrative Erzählung war, die wir gemacht haben. Vorher hatten wir auch verhalten narrativ gearbeitet, in den neunziger Jahren gab es aber eigentlich ein Verbot des Narrativen im Tanz.
In Ihrer Biographie scheint ein Gesang- und Tanzstudium auf, aber auch das Studium des österreichischen Rechts. War das ein Brotstudium zur Absicherung oder hat das durchaus etwas mit Ihrer Arbeit zu tun?
Das hat etwas mit meiner Leidenschaft zu tun. (lacht) Ich wollte eigentlich immer gefürchteter Rechtsanwalt werden und zu Unrecht verurteilte aus dem Gefängnis herausschlagen. Das war so meine Idee als Pubertierender, was ich gerne machen möchte. Die Kunst ist mir dann dazwischen gekommen. Ich habe mit Tanz eigentlich sehr spät angefangen, erst mit zwanzig oder einundzwanzig, als ich durch einen Zufall am Salzburger Mozarteum als Sänger aufgenommen wurde. Dort gab es eine halbwegs institutionalisierte Tanzausbildung. Die Sänger mussten auch tanzen und sind damit mit den Tänzern in Verbindung gebracht worden. Da hat sich dann bei mir dieser Shift ergeben. Als Tänzer gab’s natürlich keine Ausbildung in Österreich, also habe ich das Rechtswissenschaftsstudium geführt und wollte eigentlich nicht als Tänzer oder Sänger arbeiten, sondern das nur zu meinem Vergnügen machen.
Was hat man von Ihnen an zukünftigen Projekten zu erwarten?
Wir machen am 3. September die Klangwolke in Linz, auch ein großes narratives Projekt. Es ist eine Geschichtserzählung, eine history fiction. Die Fiktion ist, dass es 1955 anstatt zum Staatsvertrag zu einer Teilung von Österreich wie in Deutschland gekommen wäre und damit eine Ost-West-Grenze mitten durch Linz gegangen wäre. Dadurch stehen die Zuschauer an einem fiktiven eisernen Vorhang und wir spielen die Luftbrücke.
|
Von Jürgen Leidinger, Sölden 16. April 2005
ID 00000001850
Siehe auch: "Hannibal. Verlauf einer Alpenquerung"
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
THEATERTREFFEN
URAUFFÜHRUNGEN
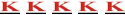
= nicht zu toppen
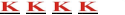
= schon gut
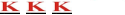
= geht so

= na ja

= katastrophal
|