Bremer Concordia, Premiere: 31.1.2007
Uraufführung: Keine Stille ausser der des Windes
Sidney Corbett
|
Ein Reisender wartet vergeblich auf Fluchtmöglichkeit, ein Beobachter besieht trübe Erinnerungen, eine Braut berichtet von ihrer Sexualfunktion, ein Zwitter bangt ob seiner geschlechtlichen Identitätsmöglichkeit, ein Hilfsbuchhalter ahnt etwas Großes und die Stimme des Buches begegnet direkt persönlich und tief. Nun, herzlich Willkommen sagt das Musiktheater des 21. Jahrhunderts im Concordia Bremen. Macht das Ich Sinn?
Der in Berlin lebende amerikanische Komponist Sidney Corbett hat sich nach seinem glänzenden Erstling „Noach“ (2001 UA Bremen) mit der Kammeroper „Keine Stille ausser der des Windes“ erneut kein leichtes Handgepäck aufgeladen, indem er sich aus dem „Buch der Unruhe“ vom „traurigsten“ portugiesischen Dichter und Denker Fernando Pessoa (1888-1935) ein Libretto basteln ließ. Basteln musste die Librettistin Simone Homem de Mello eben darum, weil die zwischen irrationalem Nihilismus und verzweifelter Suche nach festen Grund, einer Logik, einer klaren Form kreisenden Meditationen Pessoas im Grunde keine Personen, außer der des Ich-Erzählers, dem Hilfsbuchhalter Bernardo Soares, kennt, und auch nur selten „szenische“ Beobachtungen niederschreibt, wie einmal über einen Fado-Sänger, den ein Polizist zum Schweigen bringt. Pessoa betreibt meist rein analytische Reflexionen geronnenen Lissabonner Alltags auf der Rua dos Douradores, voller Sehnsucht nach Klarheit, wissend um ihre Unerreichbarkeit.
|
Aus dieser Not macht de Mello theatralische Tugend und konstruiert die sechs genannten no-dramatischen und depersonalisierten Figuren, die allesamt unterschiedliche Ich-Erlebenszustände Pessoas markieren: aus einem (englischsprachigen) Gedicht Pessoas eine Braut, aus dem unruhigen Werk die fünf weiteren. „Keine Stille ausser der des Windes“ vermittelt im Ganzen die Perspektive Pessoas auf die Welt und nicht, wie eine große Künstleroper „Pessoa“ – die man vielleicht auch eher von portugiesischen Komponisten wie António Pinho Vargas erwartete – das täte, den Blick der Welt auf Pessoa.
|
„Ich beneide alle Leute darum, nicht ich zu sein.“ (Pessoa) Und doch kreist hier alles um dieses „Ich“: Die Textsplitter um Betriebsamkeit, Reisen, Sexus, Denken, Erlösungszweifel, Identitätsnot und Isolation des freischwebenden und unbeachteten Intellektuellen (dem die Lissabonner hübsch posthum ein Denkmal vor dem Café „A Brasileira“ gesetzt haben). Vor allem aber die Musik, die überhaupt nichts nötig hat von dem, was heute so gern mit dem Wort „modern“ bezeichnet wird: laute Lautstärke, denn sie spricht, wie Debussy, meist sehr leise. Oder schnelle Geschwindigkeit, denn sie agiert zumeist langsam, getragen, ungehetzt – kann aber durchaus szenische Varianz erzeugen wie im „Sturm“. Dazu ihr Verzicht auf jegliche grelle Kurzschlusseffekte zum Beispiel durch die strenge Einbettung von Musique concrète-Elementen, wie der des Schreibers Schreibmaschine zu Beginn, die den symphonischen Fluss, ähnlich wie im „Rheingold“, aus einem einfachen Klappern entspringen lässt.
|
| Macht: Eine geschlossene „siebzehnstimmige Sinfonie“, die sowohl Stille im „Selbstgespräch“ glaubwürdig zu transportieren versteht als auch mit jazzoider Anspielungsmusik in den beiden gestopften Blechbläsern die Stille fast heiter begleiten kann, als auch im zerklüfteten Klaviersolo transzendente Klangräume zu gewinnen vermag und auch immer wieder etliche miniatürliche Motivfragmente, verschütte Glückserfahrungen, aus den hohen Streichern hervorholt. Hervorholt, und das ist das wahre Verdienst Corbetts, unter einer musikalischen Schicht, die etwas von der zweiten – durch die Librettoanforderungen notwenig verlorene – Lese-Ebene einholt. So in den sanft und langsam gezogenen Streicherfiguren, die jene pathoslose Traurigkeit Pessoas auf vollkommen einzigartige Weise hörbar werden lässt: Traurigkeit von einer dissonanten, ziehend-stechenden Beständigkeit, mit ständigen Abstürzen. Und Neueinsätzen. Quasi ein Hörbuch der besonderen, eben szenischen Art, das Corbett hier dem Bremer Publikum aufschlagen lässt. Auch in dem quasi nach Hause kommen der elf Instrumente auf einem Ton. Ist denn Sinn dem Ich doch möglich? Es wird hier eine heimliche Sehnsucht Pessoas hörbar im „Tod des Buches“: der Wunsch zu verlöschen, Begegnung zu haben mit dem wahren Objektiven: „Wir sind tot.“ Fallen zuletzt allein.
|
Verzeihlich, wenn Passagen wie „Das zweite Gespräch“ ein wenig zurückbleiben. Über ein paar Striche könnte man sicher noch nachdenken (im Sturm). So käme dieses „unendliche Rondo“ auf eine gute Stunde. Und wäre so leicht spiel- und kombinierbar. Es schließt nach den „Abschiedgesängen“: erzeugt intrazelluläre Verdichtungen, Beklemmung, ein Ineinanderziehen der Organe. Der Saal atmet schwer. Alle wissen jetzt, worum uns Pessoa nicht beneidet. In einer lichtfernen zweiteiligen Bass-Arie entlässt der Schreiber (grandios: Jörn Schümann) die „Gestaltlosen“, wie Pessoa die letzten Menschen nennt. Danach wirkt der allerletzte Puster freilich etwas dümmlich.
Für die Inszenierung zeichnet die „Noach“ Regisseurin Rosamund Gilmore verantwortlich und errichtet alles aus einer totalen Pseudoperspektive, die das „Pseudo“ sehr genau bestimmt: So als ob die Dinge da seien, erscheinen in dem unterbewusst weißen Raum (Bühnenbild/Kostüme: Carl Friedrich Oberle) „Personen“, „Bücher“, „Spiegel“, „Manuskriptseiten“. Die Figuren, eben so als ob sie sich bewegen, als ob sie leben, sehen, denken oder gar fühlen. Am Ende weiß man eben nicht so genau, ob man wirklich eine Braut gesehen hat, die sich selbst die Rückhandseite und Unterarme küsst oder eine Schmetterlingsbewegung nachahmende, schwarz-weiß-bicodierte Zwitterfigur, die alberne Mimiken draufschaltet. Gilmore entwirft immer wieder aus dem Alltag entlehnte Choreografien, die dann in Standbildern des Ich-Zerfalls kulminieren. Das kommuniziert von innen her mit der Reflexionsrichtung Pessoas.
Der opernkonservative, syllabische Gesang wird vorzüglich von dem Tenor Benjamin Bruns (Beobachter), dem Mezzo Sybille Spechts (Reisender), dem lyrischen Sopran Nadine Lehners, gut von dem Alt Eva Gilhovers und dem Countertenor Matthias Kochs (zusammen: Zwitter) ausgestaltet. Einen akzentuierten Hilfsbuchhalter spricht, mal lustig, mal bedächtig, mal ernst Christoph Hohmann. Durch den Abend führt das besonnene Dirigat des Kapellmeisters Christian Günther.
Mehrfaches Hören empfiehlt sich: Keine Stille außer der des Musiktheaters. Das Concordia erweist sich diesbezüglich als idealer Ort für kammermusikalische, auch neue Musiktheaterformen, offene Konzeptionen und Work in Progress-Tanzevents. Wer die hermetische, unflexible, sterile und wenig einladende Hamburger Opera Stabile kennt, findet es unfassbar, dass die Bremer Stadtelefanten, Kultursenator und neue Intendanz, diesen Spielort, der ganz billig zu halten wäre, aufgeben werden. Schlichtweg ein kulturpolitischer Suizidversuch auf Kosten der nächsten Generation.
|
Wolfgang Hoops - red / 5. Februar 2007
ID 2967
Sidney Corbett
KEINE STILLE AUSSER DER DES WINDES
Christian Günther - Musikalische Leitung
Rosamund Gilmore - Inszenierung
Carl Friedrich Oberle - Ausstattung
Ks. Eva Gilhofer - Der Zwitter
Nadine Lehner - Die Braut
Sybille Specht - Der Reisende
Benjamin Bruns - Der Beobachter
Christoph Hohmann - Der Hilfsbuchhalter
Matthias Koch - Der Zwitter
Jörn Schümann - Der Schreiber / Die Stimme des Buches
Weitere Infos siehe auch: http://www.bremertheater.com
|
|
|
Anzeigen:


Kulturtermine
TERMINE EINTRAGEN
Rothschilds Kolumnen
BALLETT |
PERFORMANCE |
TANZTHEATER
CASTORFOPERN
DEBATTEN
& PERSONEN
FREIE SZENE
INTERVIEWS
PREMIEREN-
KRITIKEN
ROSINENPICKEN
Glossen von Andre Sokolowski
RUHRTRIENNALE
URAUFFÜHRUNGEN
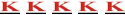
= nicht zu toppen
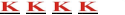
= schon gut
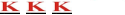
= geht so

= na ja

= katastrophal
|